Die zunehmende Relevanz
der Akademikerinnen für die Geburtenentwicklung in Deutschland
Die zunehmende
Kinderlosigkeit von Akademikerinnen ist erst in den 1990er
Jahren in den Fokus der bevölkerungspolitischen Debatte gerückt.
Erfolgreich, einsam, kinderlos hieß dann im Jahr 2005 der
Untertitel des Bestsellers
Die
Emanzipationsfalle über die nicht mehr ganz so jungen
Akademikerinnen Mitte 30 bis 40, in dem die Situation
folgendermaßen beschrieben wird.
|
Die Emanzipationsfalle
"En Drittel der 1965 Geborenen ist heute kinderlos, und
fast zwei Drittel der Akademikerinnen bis 35 Jahre haben
noch keinen Nachwuchs." (2005, S.10)
"Das Hochschulstudium
beenden Absolventinnen bei uns mit durchschnittlich 28,5
Jahren. Das Durchschnittsalter für das erste Kind liegt
heute rund fünf Jahre höher als 1960, nämlich bei knapp
dreißig Jahren. Die Akademikerinnen dürften das ihre zu
dem hohen Altersdurchschnitt beitragen: Bei ihnen
verschiebt sich die Familiengründung gut und gerne noch
einmal um fünf Jahre nach hinten, verglichen mit den
mittleren und niedrigen Bildungsgruppen..
Das muss überhaupt kein Problem sein - wenn am Ende alles
(...) wunschgemäß verläuft". (2005, S.70)
"Mit Mitte dreißig
fällt die Fruchtbarkeitskurve steil ab, danach ist es
Glückssache, ob eine Frau noch schwanger wird oder nicht.
Rund ein Drittel der Paare, die sich erst in diesem Alter
finden, bleiben daher ungewollt kinderlos." (2005, S.71)
"Bis zu ihrem
fünfunddreißigsten Lebensjahr bleiben laut Mikrozensus des
Statistischen Bundesamtes inzwischen zweiundsechzig
Prozent der Hochschulabsolventinnen kinderlos. Auch wenn
es bei ihnen einen deutlichen Trend zur »späten
Mutterschaft« mit Mitte, Ende dreißig gibt: Wie viele von
ihnen werden bis Anfang vierzig wirklich noch Kinder
bekommen? Zehn Prozent? zwanzig? Demografen gehen für die
Zukunft davon aus, dass etwa die Hälfte aller
Akademikerinnen für immer kinderlos bleiben werden."
[mehr]
(2005, S.72) |
Wie weiter oben beschrieben,
werden selbst in Westdeutschland die 1965 geborenen
Akademikerinnen nur zu ca. 30 % kinderlos bleiben, statt zu 40
oder gar 50 %. Erst der Mikrozensus 2012 wird darüber aber
genauer Aufschluss geben. Die zunehmende Relevanz der
Akademikerinnen für die Geburtenrate ergibt sich jedoch weniger
aus dem Anteil der Kinderlosen, der sogar gefallen sein könnte,
sondern aus der enormen Zunahme der Akademikerinnen. Hans
BERTRAM schreibt, dass der Anteil der Akademikerinnen im
Zeitraum von 1971 bis Mitte der nuller Jahre von 3 auf 30
Prozent gestiegen sei.
|
Starke Familie
"Überraschend ist eher, daß heute der Anteil der Frauen,
die kinderlos sind und über einen Fachhochschul- oder
Hochschulabschluß verfügen, um etwa sieben Prozent unter
der Zahl von 1971 liegt. Die Kinderlosigkeit der
Akademikerinnen fiel damals nicht auf, weil bei fünf bis
sechs Prozent Akademikern insgesamt und etwa zwei bis drei
Prozent Akademikerinnen dies nicht ins Gewicht fiel,
wohingegen das heute bei 30 Prozent sehr wohl zu einem
Thema geworden ist."
(2005, S.49) |
Die Bestimmung des Anteil der
Akademikerinnen an allen gebärfähigen Frauen ist mit Problemen
behaftet. So kommt z.B. das Statistische Bundesamt zum Ergebnis,
dass im Jahr 2003 nur 15 % der 25-44jährigen Frauen einen
akademischen Abschluss hatten (DESTATIS
06.06.2006, S.9). Da von 25-35jährigen Frauen noch etliche
einen akademischen Abschluss erreichen werden, unterschätzen
diese Zahlen die Relevanz der Akademikerinnen für die
Geburtenentwicklung.
Genaueres lässt sich dem
Bildungsbericht Bildung in Deutschland 2012 entnehmen.
Während der Anteil der Absolventinnen von Fachhochschulen bzw.
Hochschulen an der gleichaltrigen Bevölkerung im Jahr 2000 noch
16,2 % betrug, lag er 2005 bei 21,6 % und 2010 bereits bei 31,5
%. Aufgrund von "Turbo-Abitur" und Änderungen im
Hochschulbereich (Bachelor/Master statt Magister/Diplom) ergeben
sich in Zukunft weitere Zuwächse in diesem Bereich. Seit 2004
ist der Anteil der weiblichen Akademikerinnen sogar höher als
der Anteil der männlichen Akademiker an der gleichaltrigen
Bevölkerung. Was seit einigen Jahren in den Medien als das
Problem von älteren Karrierefrauen, die keinen Mann abbekommen,
problematisiert wird, das könnte sich eher als Schicksal der
jungen Akademikerinnen entpuppen, die keinen Partner zum
Kinderkriegen finden - sofern sich ihr Partnerwahlverhalten
nicht ändert. Neben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
rückt deshalb in der Forschung immer öfter das
Partnerwahlverhalten und die Partnerlosigkeit als Ursache der
Kinderlosigkeit in den Mittelpunkt.
Wer ist eine westdeutsche
bzw. ostdeutsche Akademikerin?
Erst Mitte der nuller Jahre
richtete sich das Augenmerk verstärkt auf die Unterschiede zwischen west-
und ostdeutschen Akademikerinnen. Typischerweise werden in der
Bevölkerungswissenschaft bei der Betrachtung des Gebärverhaltens
nicht ostdeutsche Akademikerinnen im Sinne der Herkunft
betrachtet, sondern lediglich Frauen, die in den neuen
Bundesländern leben. In dem Buch
Die Wendegeneration von
Karl Ulrich MAYER & Eva SCHULZE wird dagegen anhand von Daten
der Deutschen Lebensverlaufsstudie aus dem Jahr 2005 der west-
und ostdeutsche Jahrgang 1971 betrachtet. Im Jahr 2005 wurden
die 1971 Geborenen 34 Jahre alt, d.h. die Spätgebärenden des
Jahrgangs 1971 werden bei MAYER & SCHULZE nicht
berücksichtigt. Die Situation der Akademikerinnen wird lediglich
anhand von Fallstudien dargestellt. Die soziodemographischen
Daten beschränken sind dagegen auf die Gesamtheit des Jahrgangs,
da insbesondere für Ostdeutschland die Stichprobe zu klein ist,
ein Manko das auf die meisten der sozialwissenschaftlichen
Längsschnittsuntersuchungen zutrifft. Die Autoren geben einen
Überblick über die Größenveränderungen und die
Wanderungsbewegungen des Jahrgangs von der Geburt bis 2005:
|
Die Wendegeneration
"Insbesondere für die
Wendegeneration haben Zu- und Abwanderungen eine sehr
große Rolle gespielt. (...). Bis 1988 wachsen die
Westdeutschen des Jahrgangs 1971 um etwa 22.000 auf
802.000, vor allem durch Zuwanderungen der Kinder von
Arbeitsmigranten und Aussiedlern (...). Nach der
Wiedervereinigung kommen weitere 156.000 '71er nach
Westdeutschland, ganz überwiegend Ostdeutsche. Trotz des
dramatischen Geburtenrückgangs erreichte der westdeutsche
Jahrgang 1971 also fast Babyboom-Stärke.
Dagegen schrumpft der ostdeutsche Jahrgang 1971 von 1990
bis 2004 netto um 27.000 auf 196.000, also um fast 16
Prozent. Rechnet man die Zuwanderer ab, kann man davon
ausgehen, dass etwa ein Fünftel der ostdeutschen
Wendegeneration in den Westen abgewandert ist."
(2009,
S.27f.) |
Die Veränderungen des Alters
bei der Erstgeburt beschreiben MAYER & SCHULZE folgendermaßen
|
Die Wendegeneration
"Das Alter der
Erstgeburt stieg seit dem Jahrgang 1940 von 24 auf 31
Jahre, wiederum mit einem merklich stärken Aufschub für
den Jahrgang 1971. Im Gegensatz zu diesen sich
verstärkenden Trends im Westen markiert die
Wendegeneration im Osten einen enormen Bruch gegenüber
früheren Generationen. Während die vorangehenden Jahrgänge
im Osten immer früher eine Familie gründeten, verhalten
sie sich nun genau umgekehrt und schieben Heirat und
Elternschaft gleich um etliche Jahre hinaus. Ostdeutsche
Frauen der Jahrgänge 1940 bis 1960 heirateten im Mittel
(Median) jünger als 22, die des Jahrgangs 1971 dagegen erst
mit fast 33 Jahren (...). Das Alter bei der ersten Geburt
fiel über mehrere Jahrzehnte bis auf 22 Jahre für die 1960
Geborenen und stieg dann massiv um sechs Jahre auf 28
Jahre".
(2009, S.181f.) |
Die Wende hatte einen
Einfluss auf das Gebärverhalten in Ostdeutschland, das sich
drastisch auf die zusammengefasste Geburtenziffer auswirkte und
dadurch Raum für Fehlinterpretationen bot. Die von MAYER &
SCHULZE beschriebene Zweigipfeligkeit der Geburtenverteilung
verweist auf die Bildungsunterschiede, wobei es sich die Daten
jedoch auf das Gebiet und nicht auf die Herkunft beziehen.
|
Die Wendegeneration
"Obwohl Ostfrauen und
Westfrauen nach der Wiedervereinigung formal unter den
gleichen institutionellen Rahmenbedingungen, zum Beispiel
der Familienpolitik, lebten, unterschieden sich die
Kontexte der Familienbildung nach wie vor erheblich.
Günstig für die Ostfrauen war zudem, dass trotz rascher
Einschränkungen die Kinderbetreuungsangebote deutlich
besser blieben als im Westen. (...). Die altersspezifische
Geburtenrate unserer Kohorte stieg bis 1991 an, also etwa
bis zum Alter von 20 Jahren, fiel dann bis zum Alter von
23 und stieg dann wieder. Daraus resultierte eine
außergewöhnliche zweigipflige Verteilung der
alterspezifischen Geburtenrate, mit Spitzen im Alter von
20 und von etwa 28 Jahren"
(2009, S.183f.) |
1995 sehen Charlotte HÖHN &
Jürgen DORBRITZ die ostdeutschen Geburtsjahrgänge zwischen 1968
und 1975 besonders von der Wende betroffen. Sie beschreiben in
ihrem Sammelband-Beitrag Zwischen Individualisierung und
Institutionalisierung - Familiendemographische Trends im
vereinten Deutschland 3
Szenarien, wie diese Jahrgänge mit der Wende umgehen könnten.
Für die nach 1975 geborenen Frauen gehen HÖHN & DORBRITZ von
einer unproblematischen Anpassung an die westdeutschen
Verhältnisse aus.
|
Zwischen Individualisierung und Institutionalisierung -
Familiendemographische Trends im vereinten Deutschland
"Die jüngeren Generationen, die etwa zwischen 1968
und 1975 geboren wurden, sind durch das Ende der DDR
mitten in ihrer Ausbildungs-, Berufs- und
Familienbildungsphase überrascht worden (...). Das sind im
wesentlichen die Geburtsjahrgänge, die auf die soziale
Transformation mit einem Nichteintritt bzw. einem Abbruch
der Geburten- und Heiratsbiographien reagiert haben.
(...).
In welchem Maße es in diesen Altersgruppen zu einer
Pluralisierung und Individualisierung der Lebensformen
kommt, kann noch nicht beurteilt werden (...). Drei
Szenarien sind denkbar:
- Die soziale Krisensituation in den neuen Bundesländern
bleibt über einen längeren Zeitraum bestehen. Dann ist
weder ein Einleben in die Gesellschaft der früheren
Bundesrepublik (...), noch ein Leben der DDR-Muster zu
erwarten. Für die Entwicklung der Lebensformen bedeutet
das eine Pluralisierung (...).
- Setzt eine relativ schnelle Konsolidierung der
Verhältnisse ein, könnte versucht werden, zunächst die
DDR-Muster weiter zu leben. Eine Pluralisierung der
Lebensformen würde dann erst über mögliche Ehescheidungen
einsetzen.
- Unabhängig davon, wie die soziale Entwicklung verläuft,
könnte (...) auch eine schnelle Annäherung an die im
Westen bestehende Biographiemusterstruktur einsetzen.
Diese Variante gilt aber nur für
»Erfolgreiche«.
(1995, S.172f.) |
Sowohl für West- als auch
Ostdeutschland gehen HÖHN & DORBRITZ von einer Dominanz von Ehe-
und Familienorientierung aus. Ein gravierender Fehlschluss
(siehe auch weiter oben), den Dirk KONIETZKA & Michaela
KREYENFELD in ihrem
Sammelband-Artikel Zwischen soziologischen Makrotheorien
und demographischen Vorausberechnungen aus dem Jahr 2009 beispielhaft für die Möglichkeiten und Grenzen
der Vorhersage von Geburtenentwicklungen beschreiben:
|
Zwischen soziologischen Makrotheorien und demographischen
Vorausberechnungen
"Das Beispiel (...) ist gerade deshalb interessant, weil
zu Beginn der 1990er Jahre in der Forschung relativ
präzise Erwartungen über die weitere Entwicklung dieses
Phänomens formuliert wurden. Die entsprechenden Thesen
lassen sich rückblickend gut überprüfen.
Ausgangspunkt der Betrachtungen war zunächst die Tatsache,
dass der Anteil nichtehelicher Geburten in der DDR vor
allem in den 1970er Jahren stark gestiegen war und 1989
einen Höchststand von 33 Prozent erreicht hatte (...).
Dieser Anstieg wurde primär durch bestimmte
sozialpolitische Anreizfaktoren erklärt. (...). Durch die
deutsche Einheit im Oktober 1990 änderten sich jedoch die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nichtehelicher
Mutterschaft in Ostdeutschland grundlegend. Die Regelungen
(...) erhöhten nunmehr die Anreize zu heiraten deutlich.
Aufgrund des Wegfalls der besonderen sozial- und
familienpolitischen Anreize und der zugleich stärkeren
ökonomischen Gefährdung nicht verheirateter Mütter nach
1990 (...) wurde erwartet, dass in Ostdeutschland wieder
eine
»engere
Verbindung von Ehe und generativem Verhalten« (Höhn/Dorbritz
1995:171) eintreten und die Anteile nichtehelicher
Geburten an allen Geburten entsprechend sinken würden.
Lediglich ein vorübergehendes Festhalten an den alten
Verhaltensmustern in einem Kontext normativer
Desorientierung oder in Sinne eines »cultural lag« wurde
für möglich gehalten (...).
Jene Prognosen, die einen Rückgang des Niveaus
nichtehelicher Geburten vorhersagten, haben sich
bekanntermaßen als spektakulär unrichtig erwiesen. Der
Anteil nichtehelicher Geburten ist in den neuen
Bundesländern in den 1990er Jahren immer weiter gestiegen.
Im Jahr 1999 waren 50 Prozent und im Jahr 2005 59 Prozent
aller Geburten nichtehelich (...). Aber auch in
Westdeutschland ist der Anteil nichtehelich geborener
Kinder im Verlauf der 1990er Jahre kontinuierlich
gestiegen. Er lag im Jahr 2005 bei 23 Prozent. Die Dynamik
der nichtehelichen Geburten ist also in Deutschland nach
1990 genau in die entgegengesetzte Richtung erfolgt. Die
Entwicklung der nichtehelichen Geburten ist damit ein
illustratives Beispiel für die Probleme, sozialen Wandel
im Bereich von Fertilität, Partnerschaft und Lebensformen
zu antizipieren - selbst für vergleichsweise eng
abgesteckte Gegenstandsbereiche und -zeiträume."
(aus: Zukunft der Familie Sonderheft 6 Zeitschrift für
Familienforschung 2009, S.62)
|
Wenn man den Fokus auf die
Herkunft legt, dann lassen sich für ostdeutsche Frauen bzw.
Akademikerinnen drei Typen unterscheiden:
1) Ostdeutsche Frauen, die im
Osten geblieben sind
2) ostdeutsche Frauen, die dauerhaft in den Westen abgewandert
sind und
3) ostdeutsche Frauen, die zeitweise in den Westen gegangen sind.
MAYER & SCHULZE haben für den
Frauenjahrgang 1971 hervorgehoben, dass es bei den ostdeutschen
Frauen, die dauerhaft im Westen leben zur Überanpassung an das
westdeutsche Erstgeburtsalter gekommen ist, während sich die
dagebliebenen bzw. zurückgekehrten ostdeutschen Frauen durch ein
niedrigeres Erstgeburtsalter auszeichnen.
|
Die Wendegeneration
"Hinausschieben des
Kinderwunsches ist bei hochqualifizierten Westfrauen die
Regel. Ostfrauen, die im Westen leben, haben sich dem in
ihrem Verhalten noch stärker angenähert als die, die in
Ostdeutschland wohnten". (2009,S.219)
"Die ostdeutschen
Frauen in unserer Panelstichprobe, die in Westdeutschland
wohnten, hatten erst mit 29 Jahren zu einem Viertel
Kinder, im Vergleich zu den ostdeutschen Frauen, die im
Osten blieben oder zurückgekehrt sind. Sie sind 22 Jahre
alt, wenn ein Viertel von ihnen Mutter wird. Von den
»Westmigrantinnen«
hatte im Alter von 34 Jahren noch nicht einmal die Hälfte
Kinder"
(2009, Fn S.219) |
Auch hinsichtlich des
Kinderwunsches finden MAYER & SCHULZE herkunftsbedingte
Unterschiede, die besonders die Männer betreffen sollen ("Später-Vielleicht-Männer"):
|
Die Wendegeneration
"Bei den von uns
Interviewten zeigen sich die größten Unterschiede in den
Motiven für eine Familiengründung und beim Kinderwunsch
zwischen den ost- und den westdeutschen Männern. Von den
Westmännern haben im Alter von 34 Jahren 47 Prozent
Kinder, unter den Ostmännern haben in diesem Alter schon
54 Prozent Nachwuchs. (...). Die noch kinderlosen
westdeutschen Männer sind ausgesprochen ambivalent, was
die Familiengründung anbelangt. (...). Die ostdeutschen
Männer unseres Jahrgangs zeigen dagegen eine ausgeprägte
Familienorientierung."
(2009, S.219f.)
"Auch bei den Frauen
sind die Unterschiede zwischen einer Sozialisation im
Osten und einer im Westen deutlich, wenn auch nicht ganz
so gravierend wie bei den Männern. Die westdeutschen
Frauen unserer Kohorte, die im Alter von 34 Jahren noch
keine Kinder hatten, unterliegen der
Familiengründungs-Ambivalenz ihrer (potentiellen) Partner.
Sie haben oft einen starken Kinderwunsch, konnten aber
bislang nicht den passenden Partner finden, der mit ihnen
das Projekt Familie realisieren mochte. (...). Die
Vorstellung, ein Kind allein zu erziehen, ist für
westdeutsche Frauen weitaus problematischer als für
ostdeutsche."
(2009, S.221) |
Die "Später-Vielleicht"-Männer
(vgl. Meike Dinklage "Der Zeugungsstreik", 2005)
sind jedoch eher im Akademikermilieu der Kreativen zu finden,
was darauf verweist, dass dieses Milieu in
sozialwissenschaftlichen Studien überrepräsentiert ist.
Wenn man das Gebiet, statt
die Herkunft betrachtet, dann ergeben sich weitere Konfusionen,
denn die Daten zur Kinderlosigkeit der Akademikerinnen können
sich auf verschiedene Teilgebiete beziehen: Deutschland, alte
Bundesländer/früheres Bundesgebiet bzw. die neue Bundesländer.
Bevölkerungswissenschaftler wie Herwig BIRG unterscheiden z.B.
nicht besonders zwischen früherem Bundesgebiet und Deutschland.
Manfred G. SCHAREIN sieht die Angelegenheit ebenso entspannt,
denn bei der Betrachtung der westdeutschen Akademikerinnen würde
sich im Gegensatz zur Betrachtung der gesamtdeutschen
Akademikerinnen der Wert lediglich um 3 % erhöhen:
|
Kinderlose Akademikerinnen 0.3 - Wo war das Problem?
"Welchen
Einfluss hat aber die Wahl eines bestimmten Gebietes, also
West-/Ost- oder Gesamtdeutschland, für das Ergebnis bei
der Berechnung der Kinderlosigkeit von Akademikerinnen?
Dies kann man an Hand der Ergebnisse der
Mikrozensusbefragung des Jahres 2008 ablesen, bei der
erstmalig alle Frauen zwischen 15 und 75 Jahren nach der
Anzahl der von ihnen geborenen Kindern befragt erden
konnten (...). Es resultierte gemäß der Presseerklärung
(...), dass »28 % der westdeutschen Akademikerinnen von 40
bis 75 Jahren keine Kinder (hatten; der Autor)«. Für die
ostdeutschen Bundesländer (ohne Berlin) resultiert ein
Wert elf Prozent, sodass sich für Gesamtdeutschland gemäß
dem Mikrozensus 2008 eine Quote für die kinderlosen
Akademikerinnen von 25 Prozent ergibt. So mit lässt sich
folgern, dass eine Festlegung der Betrachtung auf rein
westdeutsche Akademikerinnen das Resultat im Vergleich zu
einer gesamtdeutschen Analyse um cirka drei Prozentpunkte
erhöht."
(Bevölkerungsforschung Aktuell, Heft 3, 2011, S.26) |
So einfach wie SCHAREIN das
darstellt, ist die Sachlage jedoch nicht. In manchen
Darstellungen wird Berlin bei der Betrachtung von
Ost- und Westdeutschland nicht ausgeklammert, sondern z.B. den neuen
Bundesländern zugeschlagen. Der Mikrozensus 2008 weist für die
1964-1973 Geborene einen Anteil von 23 % für Deutschland aus.
Für Westdeutschland ohne Berlin ergeben sich 24,5 %. Dieser
Anteil erhöht sich lediglich um 0,3 %, wenn man Berlin
hinzurechnet. Für Ostdeutschland ohne Berlin werden 12,8 %
ausgewiesen. Rechnet man jedoch Berlin hinzu, dann erhöht sich
der Anteil der Kinderlosen in Ostdeutschland um fast ein
Drittel. Die Darstellung divergiert zuweilen sogar in ein und
demselben Buch. Im Handbuch der Gesellschaft Deutschlands
(2013), herausgegeben von Steffen MAU u. a. weist Johannes
HUNINK den Kinderlosenanteil für West, Ost und Berlin getrennt
aus, während Dirk KONIETZKA & Michaela KREYENFELD Berlin zu
Ostdeutschland hinzu rechnen. Für den Frauenjahrgang 1959-1963
ergeben sich dann folgende Angaben:
|
Kinderlose des Frauenjahrgangs 1959-1963 für verschiedene
Gebietseinheiten (Angaben in Prozent) |
| |
1959-1963
Geborene |
|
West (ohne Berlin)* |
21
|
|
Berlin* |
25,5 |
| Ost
(ohne Berlin)* |
7,8
|
| Ost
(mit Berlin)** |
12 |
|
Deutschland*** |
21 |
|
Quellen: *Johannes Huinink (2013, S.103); **Dirk Konietzka
& Michaela Kreyenfeld (2013, S.263); ***Dieter Emmerling
in
Wirtschaft und Statistik, Heft 9/2012, S.749
|
Der Anteil der Kinderlosen in
Westdeutschland und Deutschland unterscheidet sich hier nur im
Kommabereich, während die Hinzurechnung von Berlin zu
Ostdeutschland den Anteil der Kinderlosen um 4 % erhöht.
Das
Kinderberücksichtigungsgesetz in der Pflegeversicherung
Im Jahr 2001 hat das
Bundesverfassungsgericht aufgrund der überhöhten
Kinderlosenzahlen von Herwig BIRG gefordert, dass Kinderlose
einen erhöhten Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen müssen. Mit
dem Kinderberücksichtigungsgesetz ist die Bundesregierung dem
nachgekommen. Seit dem 1. Januar 2005 müssen Kinderlose mehr als
Eltern für die Pflegeversicherung zahlen. Dies wäre eine gute
Möglichkeit gewesen, die Anzahl der Kinderlosen zu erfassen.
Tatsächlich wurde eine solche Statistik jedoch verhindert,
sodass es nur Schätzwerte gibt. Auf eine Anfrage im Bundestag
wurde lapidar geantwortet, dass die "ursprünglich geschätzte
Größenordnung" in etwa erreicht wurde", d.h. es gab weniger
Kinderlose als erwartet. Da in den Berichten zur Entwicklung der
Pflegeversicherung der Beitrag der Kinderlosen keine Rolle
spielt, ist daraus zu schließen, dass der Anteil der Kinderlosen
sich eher nicht erhöht hat. Ansonsten hätte sich die
Familienlobby ganz sicher lautstark bemerkbar gemacht.
|
Dritter Bericht über die Entwicklung der
Pflegeversicherung
"Die Beitragserhöhung für Kinderlose führt in der sozialen
Pflegeversicherung zu einer Einnahmeverbesserung von rd.
700 Mio. € jährlich, so dass der Beitragssatz bis in das
Jahr 2008 hinein stabil gehalten werden kann. Dadurch wird
zeitlich die gründliche Vorbereitung einer umfassenden
Pflegereform ermöglicht."
(2004, S.32)
Situation
und weitere Entwicklung im Pflegebereich
"1. Wie hoch waren im
Jahr 2005 die absoluten Mehreinnahmen durch den seit 1.
Januar 2005 erhobenen Zuschlag für kinderlose Versicherte
in Höhe von 0,25 Prozent in der Sozialen
Pflegeversicherung?
Die Einnahmen aus dem
Kinderlosenzuschlag werden aus verwaltungsökonomischen
Gründen statistisch nicht gesondert ausgewiesen, sondern
zusammen mit den übrigen Beiträgen der verschiedenen
Beitragszahlergruppen erfasst. Gleichwohl lässt sich aus
der Gesamtentwicklung der Einnahmen im Jahr 2005 ableiten,
dass die ursprünglich geschätzte Größenordnung von rd. 0,7
Mrd. Euro in etwa erreicht wurde."
(Bundestag-Drucksache 16/1297 v. 26.04.2006)
Vierter Bericht über die Entwicklung der
Pflegeversicherung
"Im
Jahr 2005 hatte die soziale Pflegeversicherung Einnahmen
in Höhe von 17,49 Milliarden Euro. (...). Der starke
Anstieg der Beitragseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr
(plus 4,4 vom Hundert) geht fast ausschließlich auf die
Zusatzeinnahmen aus dem Kinderlosenzuschlag zurück."
(2008, S.28) |
Die Ruhe an dieser
politischen Front kann also durchaus als Indiz dafür gewertet
werden, dass sich die Kinderlosenzahlen nicht so entwickelt
haben wie von Herwig BIRG prognostiziert. Wie gravierend die
Fehleinschätzung von Herwig BIRG war, das wird im nächsten
Kapitel deutlich.
Warum die Entwicklung der
Haushaltszahlen und die Entwicklung der zusammengefassten
Geburtenziffer keine geeigneten Indikatoren für die Prognose der
Geburtenentwicklung in Deutschland sind
Im Heft 1/1998 der
Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft prognostizierte der
Bevölkerungswissenschaftler Jürgen DORBRITZ die
Geburtenentwicklung in Deutschland. Er kam zum Fehlschluss, dass
die zusammengefasste Geburtenziffer (TFR) bei weiterer
Ausbreitung der "Ehe- und Kinderlosigkeit" bis zum Jahr 2010 auf
1,0 absinken könnte, um dort bis 2020 zu verharren. Dagegen ist
annähernd das mittlere Szenario (Einfrieren der Geburtenrate bis
2010 bei 1,4) eingetroffen, obwohl sich der
Nichtfamiliensektor
weiter ausdehnte und die Ehe- und Kinderlosigkeit zunahm.
|
Kinderlosigkeit in Deutschland und Europa - Daten, Trends
und Einstellungen
"In
Deutschland ist ein ansteigender Fertilitätstrend in der
näheren Zukunft mit Sicherheit und auch längerfristig kaum
zu erwarten (...). In einem günstigen Fall, dem Einfrieren
der voranschreitenden Bevölkerungspolarisierung in einen
Familiensektor (...) und einen Nichtfamiliensektor
(kinderlose Lebensformen - Alleinlebende (Singles),
kinderlose Ehepaare, kinderlose nichteheliche
Lebensformen, living apart together) und der
Individualisierung der Lebensformen, könnte sich die
zusammengefaßte Geburtenziffer auf dem heutigen Niveau
stabilisieren. Möglich ist auch ein erneuter Rückgang der
zusammengefaßten Geburtenziffer nach dem Jahr 2000, der
dann eintreten wird, wenn es zu einer weiteren Ausbreitung
des Verhaltensmusters »Ehe- und Kinderlosigkeit« kommt.
Ein Wiederanstieg der Geburtenhäufigkeit oder auch eine
Stabilisierung des heutigen Niveaus hätten eine Zunahme
dritter und weiterer Kinder in den Familien zur Bedingung.
Das in einer langen Tradition verfestigte Muster niedriger
Kinderzahlen läßt eine solche Annahme jedoch kaum zu."
(1998, S.196)
"Ein mögliches weiteres
Anwachsen der Kinderlosigkeit ist der zentrale Faktor, der
einen weiteren Geburtenrückgang bewirken kann. (...). Ein
Absinken der zusammengefaßten Geburtenziffer auf Werte
zwischen 0,8 und 1,2 könnte dann möglich sein. Wobei der
Wert von 0,8 bereits als Extremsituation, so wie sie
kurzzeitig in den neuen Bundesländern bestand, anzusehen
ist. Dagegen ist ein Absinken auf den Wert 1,0, der z.B.
in Norditalien gemessen wird, nicht unwahrscheinlich und
im Bereich der abwegigen Szenarien anzusiedeln."
(1998, S.207) |
Ein Hauptgrund ist die
Fehleinschätzung der Paritätsverteilung der Geburten, d.h. der
Anteile von Kinderlosen bzw. Frauen mit 1, 2 und mehreren
Kindern, in Deutschland gewesen. Die deutschen
Bevölkerungswissenschaftler sind von einem engen Zusammenhang
des Gebärverhaltens mit der Heirat ausgegangen (kindorientierte
Heirat), wobei sich die ostdeutschen Frauen an die westdeutschen
Verhältnisse anpassen sollten. Dies wird aus dem nachfolgenden
Schaubild deutlich, das die Zahlen von DORBRITZ mit den Werten
des Mikrozensus 2008 vergleicht.
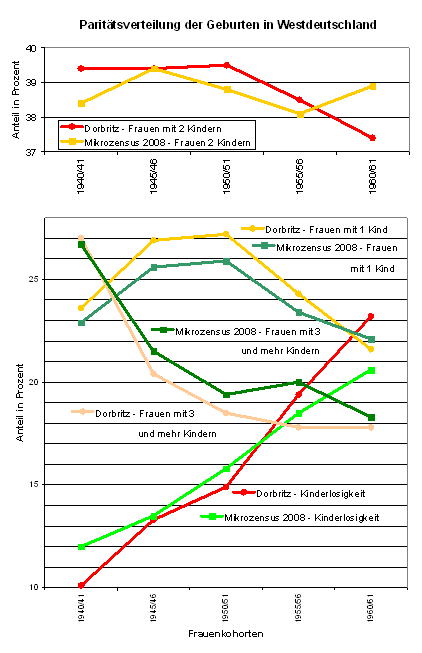 |
|
Quellen:
François Höpflinger, 2012, S.69 und eigene Berechnungen;
Jürgen Dorbritz 1998, S.200
Anmerkungen:
Der Mikrozensus 2008 fasst immer 5 Frauenjahrgänge
zusammen. Im Schaubild wird nur die mittlere Jahreszahl
angegeben (Beispiel: 1935 steht für die Jahrgänge
1933-1938); Dorbritz hat die Frauenjahrgänge 1940, 1945,
1950, 1955 und 1960 betrachtet
|
DORBRITZ selber zwingt seine
Befunde folgendermaßen mehr oder weniger gewaltsam in sein
Polarisierungskorsett:
|
Kinderlosigkeit in Deutschland und Europa - Daten, Trends
und Einstellungen
"Der
Rückgang der Kinderzahlen wurde bei den zwischen 1940 und
1945 geborenen Frauen über einen Rückgang des Anteils
dritter und weiterer Kinder erreicht. Gleichzeitig ist die
Kinderlosigkeit reduziert worden, so daß sich eine
Dominanz der Zwei-Kind-Familie herausbildete"
(1998, S.201) |
Diese Interpretation wird
nicht einmal durch seine eigenen Zahlen gestützt. Weder ist die
Kinderlosigkeit reduziert worden, sondern in Westdeutschland um
3,2 % gestiegen. Lediglich in Ostdeutschland gab es einen
Rückgang um 0,4 %. Der Anstieg der Frauen mit nur einem Kind im
Westen um 3,3 % wird schlichtweg ignoriert (Osten 0,2 %
Rückgang). Die Dominanz der 2-Kind-Familie war bereits bei den
1940/41 geborenen Frauen gegeben, schließlich bleiben die Werte
unverändert. Lediglich die Anteile der Frauen mit 1 und
die Anteile der Frauen mit 3 und mehr Kindern haben ihre Plätze
getauscht.
Betrachtet man dagegen die
Werte des Mikrozensus 2008, dann war die Kinderlosigkeit der
1940/41 geborenen Frauen um fast 2 % höher als von DORBRITZ
ermittelt. Es gab deshalb keinen Anstieg um 3,3 %, sondern
lediglich um 1,5 %. Den Rückgang der Frauen mit 3 und mehr
Kindern findet man in ähnlicher Weise in beiden Erhebungen. Der
Anstieg der Frauen mit 2 Kindern um 1 % bleibt bei DORBRITZ
unerkannt, weil zum einen das Niveau der Frauen mit 1 Kind in
den Jahrgängen 1940/41 überschätzt wurde (0,7 %) und zum anderen
auch der Anstieg (3,3 % statt 2,7 %).
Wie lassen sich diese
Abweichungen erklären? Die 1940-1945 geborenen Frauen gehören
zur 68er-Generation, die in den 1970er Jahren einen
Scheidungsboom generierten. Bei Wiederheirat der Frau und Geburt
eines Kindes, wird dieses Kind als erstes Kind der Frau gezählt,
selbst wenn sie in der ersten Ehe bereits 1 oder sogar 2 Kinder
geboren hat.
Die Veränderungen bei den
nach 1950 geborenen Frauenjahrgängen interpretiert DORBRITZ
folgendermaßen:
|
Kinderlosigkeit in Deutschland und Europa - Daten, Trends
und Einstellungen
"In
den jüngeren Geburtsjahrgängen (ab 1950) sind die Anteile
zweiter, dritter und folgender Kinder unverändert
geblieben. Nach wie vor dominiert die Zwei-Kind Familie.
Es findet aber eine Abnahme des Anteils erster Kinder und
eine Zunahme der Kinderlosigkeit statt."
(1998, S.201) |
Tendenziell stimmt dieser
Befund, wenn man den Rückgang der 2 Kind-Familie um 2,1 %, den
Rückgang der Frauen mit 3 und mehr Kindern um 0,7 % als
"unverändert geblieben" akzeptiert. Tatsächlich wird von
DORBRITZ ein Rückgang der 1-Kind-Familie um 5,6 % und den
Anstieg der Kinderlosigkeit um 8,3 % konstatiert. Der
Mikrozensus weist dagegen nur einen Anstieg der Kinderlosigkeit
von 4,8 % und einen Rückgang von 3,8 % bei den 1-Kind-Familien
in Westdeutschland aus. Während das Niveau der Frauen mit 2 bzw.
3 und mehr Kindern im Mikrozensus 2008 etwas höher liegt als bei
DORBRITZ.
Im Jahr 2001 erschien das
viel beachtete Buch Die demographische Zeitenwende von
Herwig BIRG, der
entscheidend die öffentliche Debatte geprägt hat. BIRG setzt in
dem Buch häufig die Zahlen für Westdeutschland mit den Zahlen
für Gesamtdeutschland gleich, ohne dies kenntlich zu machen
(vgl. 2001, S.73-77). Deshalb werden hier nun seine - auch nur
in Westdeutschland erhobenen - Zahlen mit den Mikrozensuszahlen
2008 für Westdeutschland verglichen. Auf den ersten Blick ist
auf dem nachfolgenden Schaubild zu erkennen, dass es sehr große
Abweichungen zwischen den Zahlen von BIRG und dem Mikrozensus
2008 gibt und zwar nicht nur bei den Mitte der 1960er Jahren
geborenen Frauen.
|
Paritätsverteilung
der Geburten in Westdeutschland |
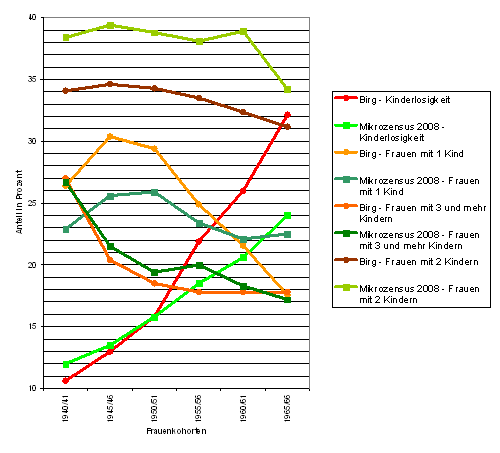 |
|
Quellen:
François Höpflinger, 2012, S.69 und eigene Berechnungen;
Herwig Birg 2001, S.77
Anmerkungen:
Der Mikrozensus 2008 fasst immer 5 Frauenjahrgänge
zusammen. Im Schaubild wird nur die mittlere Jahreszahl
angegeben (Beispiel: 1941 steht für die Jahrgänge
1939-1943); Birg hat die Frauenjahrgänge 1940, 1945, 1950,
1955, 1960 und 1965 betrachtet
|
Wie bereits weiter oben
erwähnt, wurde die Kinderlosigkeit der Mitte der 1960er Jahren
geborenen Frauen von BIRG um über 50 % überschätzt. Im Schaubild
wird deutlich, dass BIRG geschätzt hat, dass die Kinderlosigkeit
sogar den Anteil der Frauen mit 2 Kindern übertrifft. Wie ist
diese krasse Fehleinschätzung zu erklären? LUY & PÖTZSCH (2011)
schreiben in ihrem bereits erwähnten Artikel zur
Tempobereinigung über das Datenmaterial von Herwig BIRG:
|
Schätzung der
tempobereinigten Geburtenziffer für West- und Ostdeutschland,
1955-2008
"Birg
et al. (1990) lieferten eine Schätzung für die
paritätsspezifische Aufteilung der Geburten in der
Bundesrepublik Deutschland für die Jahre 1958 bis 1985.
Grundlage der Schätzungen waren die im Jahr 1986 im Rahmen
des von der DFG geförderten Forschungsprojekts
»Arbeitsmarktdynamik, Familienentwicklung und generatives
Verhalten« erhobenen Familienbiografien von 793 Frauen und
783 Männern der Geburtsjahrgänge 1950 und 1955 aus
Düsseldorf, Hannover, Bochum, Gelsenkirchen, Gronau,
Ahaus, Vreden und Leer. Die Familienbiografien beinhalten
für jedes geborene Kind sowohl die tatsächliche
Ordnungsnummer als auch die Ordnungsnummer nach der
damaligen Zählkonvention der amtlichen Statistik. Aus den
entsprechenden (mit Hilfe linearer Regression für die
Einzelalter der Mütter gewonnenen) relativen Häufigkeiten
wurden sowohl die paritätsspezifischen ehelichen Geburten
als auch die in der amtlichen Statistik nicht
paritätsspezifisch erfassten außerehelichen Geburten in
eine Schätzung der biologischen Paritäten nach Einzelalter
der Mutter überführt. Dabei wurden für alle Jahre von 1958
bis 1985 die identischen aus der Projektstichprobe
erhaltenen paritätsspezifischen Aufteilungen der ehelich
und nicht ehelich geborenen Kinder zu Grunde gelegt."
(2011, S.576f.) |
Es darf also kaum verwundern,
dass eine Paritätsverteilung, die Mitte der 1980er Jahre
ermittelt wurde, und seitdem von Herwig BIRG unverändert auf
alle Frauenjahrgänge angewandt wurde, kaum mehr das
Gebärverhalten der Gegenwart wiederspiegeln kann. Schließlich
hat sich seitdem sowohl das Heirats- als auch das Timing und die
Zusammensetzung der Bevölkerung gravierend verändert. Es ist
deshalb mehr als erstaunlich, dass die Interpretationen von
Herwig BIRG nicht nur in Politik und Medien, sondern auch in der
Wissenschaft kaum auf Kritik gestoßen sind.
Michaela KREYENFELD hat in
ihrer Doktorarbeit Employment and Fertility - East Germany in
the 1990s vom November 2001 ihre Schätzungen zur
Paritätsverteilung in Westdeutschland auf der Basis des
Sozioökonomischen Panels mit dem Mikrozensus 1997, dem German
Family and Fertility Survey 1992 und Schätzungen von DORBRITZ &
SCHWARZ (1996) verglichen, die identisch sind mit jenen, die
weiter oben DORBRITZ (1998) entnommen wurden. KREYENFELD
kritisiert zu Recht, dass wenig Anstrengungen unternommen
wurden, um die verschiedenen, oft widersprüchlichen Ergebnisse
auf ihre Abhängigkeit hinsichtlich der verwendeten Methoden und
Datensätze einzuschätzen.
Die Abweichungen in der
Paritätsverteilung sind jedoch bei den zwischen 1940 und 1960
geborenen Frauen noch nicht so gravierend wie bei den ab Mitte
der 1960er Jahren geborenen Frauen. Deren Gebärverhalten hat
sich nicht so entwickelt wie von DORBRITZ prognostiziert. Dies
liegt insbesondere am Strukturwandel der Bevölkerung, d.h. dem
wachsenden Anteil höher gebildeter Frauen in Deutschland. Deren
haushaltsübergreifende Lebensformen( z.B. beruflich bedingte
Fernbeziehungen; Kinder, die beim Vater leben) werden vom
Mikrozensus nicht adäquat abgebildet. Erst der Mikrozensus 2012
wird letztlich Klarheit schaffen über die tatsächliche
Entwicklung der Kinderlosigkeit. Wer aber sind die Kinderlosen?
Eine Antwort darauf könnte Aufschluss darüber geben, inwiefern
Bevölkerungspolitik überhaupt wirksam sein kann.