| |
|
| |
|
|
| |
Die Karriere eines Begriffs
Im Dezember 2002 sprach
single-generation.de vom neuen Tabuthema gewollter
Kinderlosigkeit als Reaktion auf gesellschaftliche
Entwicklungen, die im Frühjahr 2001 mit dem Pflegeurteil des
Bundesverfassungsgerichts einsetzten
 . Seitdem sind
Kinderlose permanent unter Druck geraten.
Fast 5 Jahre später - im Frühjahr 2006 - ist eine neue
qualitative Stufe erreicht. Mit dem Begriff "Kultur der
Kinderlosigkeit" wird Kinderlosigkeit als abweichendes
Verhalten thematisiert. Dazu ist die Enttabuisierung der
gewollten Kinderlosigkeit notwendig. Als Paradebeispiel für
diese bevölkerungspolitische Strategie kann der Artikel von Inge
KLOEPFER in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
vom 26. Februar 2006 betrachtet werden: . Seitdem sind
Kinderlose permanent unter Druck geraten.
Fast 5 Jahre später - im Frühjahr 2006 - ist eine neue
qualitative Stufe erreicht. Mit dem Begriff "Kultur der
Kinderlosigkeit" wird Kinderlosigkeit als abweichendes
Verhalten thematisiert. Dazu ist die Enttabuisierung der
gewollten Kinderlosigkeit notwendig. Als Paradebeispiel für
diese bevölkerungspolitische Strategie kann der Artikel von Inge
KLOEPFER in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
vom 26. Februar 2006 betrachtet werden:
|
Auf immer kinderlos, die deutsche Extratour
"Die Deutschen
gehen einen Sonderweg. (...). Während sich Frankreich, die
Niederlande und Skandinavien vom Geburtenknick erholen,
bleibt Deutschland mit statistischen 1,3 bis 1,4 Kinder je
Frau weit zurück. Das ist das Ergebnis alarmierender, zum
Teil noch unveröffentlichter Studien. Sie zeigen das
verheerende Ausmaß und die sozialen und wirtschaftlichen
Auswirkungen von 30 Jahren Kinderlosigkeit in Deutschland.
(...).
Im Klartext: Deutschland schrumpft, weil rein zahlenmäßig
heute viel weniger Frauen als früher überhaupt noch als
Mütter in Frage kommen.
Tomás Sobotka (...) geht noch weiter: Eine »Kultur der
Kinderlosigkeit« nimmt der Wissenschaftler in Deutschland
wahr.
(...).
Selbst in Spanien und Italien deutet einiges wieder auf eine
Rückkehr zur Mehr-Kinder-Familie - wenn auch noch zaghaft.
(...).
Warum fahren die Deutschen eine folgenschwere Extratour?
Inzwischen wissen die Forscher: In Deutschland ist mehr
passiert als nur ein Aufschub der Geburten. Der
Timing-Effekt reicht als Erklärung nicht. Jahrzehnte lang
hat die geringe Geburtenzahl auch gesellschaftliche
Einstellungen verändert. Und zwar gründlich.
»Deutschland hat eine Gesellschaft, die für Kinderlosigkeit
optiert und diese Lebensentwürfe in hohem Maße akzeptiert«,
sagt der Bevölkerungsforscher Sobotka. Im Klartext: Über
Frauen, die keine Kinder haben, wundert sich niemand mehr.
Im Gegenteil: Wer Kinder hat, hat die Beweislast.
(...).
»Die Kinderlosen«, sagt der Ifo-Forscher Martin Werding,
»sind inzwischen zu gesellschaftlichen Vorbildern geworden,
an denen sich die ökonomische Rationalität des einzelnen
weiter formt.«
(...).
Statistisch ist die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten.
(...). Glaubt man den Soziologen und Demographen, ist es für
eine Wende zu spät. (...). »Es gibt keine Anzeichen für
einen Anstieg der Geburtenrate«, meint Werding."]
(Inge Kloepfer in der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung v. 26.02.2006) |
Der Artikel wurde so
ausgiebig zitiert, weil nun - ein Jahr später - jene Studien
erschienen sind, auf die sich Inge KLOEPFER, die
verheiratet und Mutter von drei Kindern ist, bezogen hat. Wir
können nun überprüfen, was wirklich dran ist an der Rede von der
deutschen Extratour.
Der Artikel ist auch insofern
von Bedeutung, weil er von Claus LEGGEWIE in seinem Beitrag
Eltern - Kinderlose im Sammelband
Deutschland - eine gespaltene Gesellschaft als Beleg für eine Kultur der
Kinderlosigkeit zitiert wird und dadurch Eingang in die
sozialwissenschaftliche Literatur gefunden hat:
|
Eltern - Kinderlose
"Kinderlosigkeit
ist in Deutschland ein spezielles Merkmal von
Hochqualifizierten beiderlei Geschlechts, für die im
besonderen Maße gilt, was der Zwölfte Kinder- und
Jugendbericht der Bundesregierung konstatiert hat (BMFSFJ
2005): dass »Familie« keine attraktive Lebensform mehr
darstellt. Jüngsten Umfragen zufolge kommt rund die Hälfte
der Kinderlosen seltener als einmal im Monat mit Kindern
in Kontakt. Dass Kinder jenseits der üblichen Sorgen und
Imponderabilien vor allem Freude und Glück bringen, wird
von ihnen somit kaum erfahren. Auch viele Eltern empfinden
Familie zunehmend als etwas, das sie spontan nicht
»können« und ohne externe Unterstützung nicht mehr zu
leisten imstande sind. Ausländische Forscher nehmen in
Deutschland bereits eine »Kultur der Kinderlosigkeit« (Kloepfer
2006) wahr."
(aus: Deutschland - eine gespaltene Gesellschaft 2006, S.165) |
LEGGEWIE verschweigt, dass
die ausländischen Forscher bei KLOEPFER nur der Demograph Tomás
SOBOTKA ist. Auf diesen bezieht sich auch LEGGEWIE an anderer
Stelle:
|
Eltern - Kinderlose
"Niedrige
Geburtenraten kennzeichnen alle OECD-Länder, doch weist
Deutschland die niedrigste in der EU auf und belegt in
einem Weltbankvergleich von 190 Staaten den Rang 185.
(...).
Die Einstellungen der Frauen und Männer aus der ehemaligen
DDR, wo Kinderlosigkeit geringer ausgeprägt war, passt
sich dem westdeutschen Trend an. In Europa könnte sich
eine neue, demographische Teilung ergeben: Deutschland und
Österreich gehören demnach mit den katholischen Ländern
Südeuropas und dem postkommunistischen Block zum »low-fertility-belt«
(Sobotka 2004).
(us:
Deutschland - eine gespaltene Gesellschaft
2006, S.165) |
LEGGEWIE benutzt hier
Zahlen, die auch in der "SCHIRRMACHER-Affäre" vom März 2006
 verwendet wurden,
und deren Richtigkeit von Gerd BOSBACH u.a. auf
single-generation.de widerlegt wurden verwendet wurden,
und deren Richtigkeit von Gerd BOSBACH u.a. auf
single-generation.de widerlegt wurden
 . Neben Claus LEGGEWIE wird
auch der Bevölkerungswissenschaftler Jürgen DORBRITZ in den
Medien im Zusammenhang mit dem Begriff "Kultur der
Kinderlosigkeit" zitiert. DORBRITZ spricht bereits seit den
1990er Jahren
von einer
Polarisierung zwischen Kinderlosen und Eltern. Im Heft
4/2005 der Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, das erst im
Herbst 2006 erscheinen durfte, befasst sich DORBRITZ umfassend
mit Kinderlosigkeit in Deutschland und Europa - Daten, Trends
und Einstellungen. Einzig in der Zusammenfassung des Artikels
findet sich der Begriff "Kultur der Kinderlosigkeit": . Neben Claus LEGGEWIE wird
auch der Bevölkerungswissenschaftler Jürgen DORBRITZ in den
Medien im Zusammenhang mit dem Begriff "Kultur der
Kinderlosigkeit" zitiert. DORBRITZ spricht bereits seit den
1990er Jahren
von einer
Polarisierung zwischen Kinderlosen und Eltern. Im Heft
4/2005 der Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, das erst im
Herbst 2006 erscheinen durfte, befasst sich DORBRITZ umfassend
mit Kinderlosigkeit in Deutschland und Europa - Daten, Trends
und Einstellungen. Einzig in der Zusammenfassung des Artikels
findet sich der Begriff "Kultur der Kinderlosigkeit":
|
Kinderlosigkeit in Deutschland und Europa - Daten, Trends
und Einstellungen
"Analysen
anhand verschiedener Datensätze der amtlichen Statistik,
des Mikrozensus bzw. soziologischer Befragungen
bestätigen, dass Kinderlosigkeit zumindest in
Westdeutschland auf dem Wege ist, die 30 %-Marke bei den
in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre Geborenen zu
erreichen oder diese bereits erreicht hat. Inzwischen wird
in diesem Kontext über eine Kultur der Kinderlosigkeit
gesprochen. Kinderlosigkeit könnte in Deutschland, falls
kein Rückgang eintritt, zu einem weiteren
Fertilitätsrückgang beitragen. Allerdings gibt es für
Westdeutschland auch niedrigere Angaben, so zum Beispiel
von Sobotka oder von Schmitt und Wagner zur
Kinderlosigkeit der Akademikerinnen."
(Zusammenfassung des Artikels) |
Was ist dran, an der Kultur der Kinderlosigkeit in
Deutschland?
Zu aller erst ist ein
gravierendes Versäumnis der wissenschaftlichen Forschung
festzustellen. Bei Jürgen DORBRITZ liest sich das als Spätstart
der Forschung zur Kinderlosigkeit:
|
Kinderlosigkeit in Deutschland und Europa - Daten, Trends
und Einstellungen
"Die
Forschung zur Kinderlosigkeit hat sich erst in den 1990er
Jahren und insbesondere nach dem Jahr 2000 intensiviert.
(...). Zwischen 2002 und 2004 sind 49 Arbeiten
veröffentlicht worden, zwischen 1999 und 2001 waren es 22.
(...).
Dominierend in den Darstellungen ist allerdings die Sicht
auf die ungewollte Kinderlosigkeit und die Möglichkeiten,
Abhilfe zu schaffen. (...). Die gewollte Kinderlosigkeit
oder generell die Ausmaße von Kinderlosigkeit sind noch
immer Randthemen geblieben, obwohl auch sie in jüngerer
Zeit eine zunehmende Aufmerksamkeit erfahren haben.
(aus: Zeitschrift für
Bevölkerungswissenschaft, Heft 4, 2005, S.361f.) |
Es ist auffällig, dass die
Forschung zur Kinderlosigkeit erst NACH dem Pflegeurteil des
Bundesverfassungsgerichts angelaufen ist. Man darf deshalb davon
ausgehen, dass DIE POLITIK durch einen fehlenden Anschub der
Forschung, UNTERSUCHUNGEN VERHINDERT hat. Kein Politiker wollte
wirklich wissen, welches Ausmaß die lebenslange Kinderlosigkeit
in Deutschland hat. Darauf deutet auch hin, dass
bis zur Verabschiedung des Elterngeldes im Bundestag, die hohe Kinderlosigkeit unter Akademikerinnen in den
Medien als unstrittig zu gelten hatte. Der
Wissenschaftsjournalist Björn SCHWENTKER durfte z.B. nur in
Zeit online schreiben. Erst
am Tag der Verabschiedung erschien in der ZEIT der erste
Artikel darüber, dass die lebenslange Kinderlosigkeit unter
Akademikerinnen weit geringer ist als behauptet. DORBRITZ beschreibt den
Aufmerksamkeitsschub für das Thema Kinderlosigkeit folgendermaßen:
|
Kinderlosigkeit in Deutschland und Europa - Daten, Trends
und Einstellungen
"Eine
größere politische Aufmerksamkeit hat Kinderlosigkeit mit
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur
Pflegeversicherung (für das Herwig Birg ein
Gutachten erstellt hatte) erfahren, nach dem Kinderlose
einen höheren Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen
müssen. Inzwischen sind Kinderlose im Diskurs über die
Zukunft des Wohlfahrtsstaates nahezu zu einem Feindbild
geworden. Forderungen wie »Keine Kinder - keine Rente, ein
Kind - halbe Rente« und Schuldzuweisungen an die
Kinderlosen, die für die erwartbaren Finanzierungsprobleme
der sozialen Sicherungssysteme mitverantwortlich gemacht
werden, sind laut hörbar. (...).
Die Hinweise darauf,
dass es sich vor allem bei gewollter Kinderlosigkeit nicht
nur um eigennütziges und sozial unverantwortliches
Verhalten zu Lasten von Eltern und Gesellschaft handelt,
sondern auch mit modernen Lebensstilen,
Erwerbsorientierungen, ausgeprägter Leistungsbereitschaft
und Kinder- und Familienunfreundlichkeit der Gesellschaft
zu tun hat, gehören inzwischen zu den leiseren Tönen."
(aus:
Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Heft 4, 2005,
S.363) |
Warum
erschien das Heft 4/2005 der Zeitschrift für
Bevölkerungsforschung erst im Herbst 2006 und nicht bereits
im Herbst 2005? Es wurde offenbar befürchtet, dass das
frühzeitige Bekanntwerden des Datendesasters der deutschen
Bevölkerungsstatistik die reibungslose Durchsetzung des
Elterngeldes und der höheren Beiträge für Kinderlose in der
Pflegeversicherung gefährdet hätte.
Single-generation.de
hat bereits frühzeitig auf die gravierenden Probleme bei der Schätzung
des Anteils der Kinderlosen hingewiesen
 . Die Schätzungen zum
westdeutschen Geburtsjahrgang 1965 reichen gemäß DORBRITZ von
23,3 % (Tomás SOBOTKA) bis zu 32,1 % (Herwig BIRG). Das
Pflegeurteil des Bundesverfassungsgerichts folgte den
hohen Schätzwerten von Herwig BIRG. . Die Schätzungen zum
westdeutschen Geburtsjahrgang 1965 reichen gemäß DORBRITZ von
23,3 % (Tomás SOBOTKA) bis zu 32,1 % (Herwig BIRG). Das
Pflegeurteil des Bundesverfassungsgerichts folgte den
hohen Schätzwerten von Herwig BIRG.
Die Unsicherheiten bezüglich
des Anteils der Kinderlosen in den jüngeren Geburtsjahrgängen
führen bei DORBRITZ zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen. Als Vertreter
der Polarisierungsthese orientiert sich DORBRITZ an den
Schätzungen von Herwig BIRG, während er bei den verschiedenen
Berechnungen nachweist, dass die Schätzungen von BIRG zu hoch
sind. Die Folgen dieser Taktik sind verheerend, denn aus den
einzelnen Berechnungen ergibt sich kein einheitliches Bild,
sondern das Desaster wird durch den Versuch, die
Widersprüchlichkeiten zu glätten, nur umso deutlicher sichtbar.
Die
Datenkatastrophe bahnte sich nicht erst in den 1990er Jahren an. Sie gründet in einer Grundannahme
der Polarisierungsthese, nach der Ehelosigkeit eng mit
Kinderlosigkeit verbunden sein soll
 .
Bereits im Beitrag Zwischen Individualisierung und
Institutionalisierung - Familiendemographische Trends im
vereinten Deutschland haben Charlotte HÖHN und Jürgen
DORBRITZ im Jahr 1995 die Polarisierungsthese vertreten. Für
Westdeutschland heißt es dazu: .
Bereits im Beitrag Zwischen Individualisierung und
Institutionalisierung - Familiendemographische Trends im
vereinten Deutschland haben Charlotte HÖHN und Jürgen
DORBRITZ im Jahr 1995 die Polarisierungsthese vertreten. Für
Westdeutschland heißt es dazu:
|
Zwischen Individualisierung und Institutionalisierung -
Familiendemographische Trends im vereinten Deutschland
"Die
zunehmende Kinderlosigkeit wird durch die gestiegene
Wahrscheinlichkeit verheirateter Frauen kompensiert,
Kinder zu gebären (...). Das heißt, daß sich die
Verknüpfung von Ehe und Elternschaft eher verstärkt als
abgeschwächt hat. Und da auch das komplementäre Muster
»Ehe- und Kinderlosigkeit« fest verkoppelt ist, zieht das
unweigerlich eine Bevölkerungspolarisierung nach sich."
(1995, S.158) |
Für die neuen Bundesländer
gehen HÖHN & DORBRITZ davon aus, dass sich eine "engere
Verbindung von Ehe und generativem Verhalten" herausbildet: "Ein
Rückgang der Nichtehelichenquote in den neuen Bundesländern ist
zu erwarten". (S.171)
10 Jahre später muss DORBRITZ
nun eingestehen:
|
Kinderlosigkeit in Deutschland und Europa - Daten, Trends
und Einstellungen
"Bei
den Schätzversuchen am BiB ist z.B. für den
Jahrgang 1966 ein Anteil kinderloser Frauen in
Ostdeutschland von 28,2 % ermittelt worden. Dieses
Ergebnis weicht beträchtlich von den Ergebnissen des
Mikrozensus ab, in dem nur 12,7 % der Frauen ohne Kinder
im Haushalt lebte (...). Da für Westdeutschland eine sehr
hohe Übereinstimmung gefunden wurde, ist anzunehmen, dass
die Schätzungen auf der Basis des Calot-Verfahrens für die
neuen Bundesländer fehlerhaft sind. Die Ursache dürfte in
den hohen Anteilen nichtehelich Lebendgeborener liegen,
die inzwischen Werte von 55,2 % (Sachsen) und 60,8 %
(Mecklenburg-Vorpommern) erreicht haben. (...). Da auch in
Westdeutschland der Anteil der nichtehelich
Lebendgeborenen ansteigt, ist auch hier bei den jüngeren
Geburtsjahrgängen mit zunehmender Unsicherheit zu
rechnen."
(aus: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Heft 4,
2005, S.367) |
Mit dem Problem der
Erfassung der Kinderlosigkeit hat sich vor allem Michaela
KREYENFELD beschäftigt. Bereits im Jahr 2001 hat sie die Mängel
der deutschen Bevölkerungsstatistik aufgedeckt.
DORBRITZ sieht das Problem
mehr oder weniger nur auf die alten Bundesländer beschränkt.
Aber bereits die unterschiedlichen Schätzungen für den
westdeutschen Frauenjahrgang 1965, mit einer Differenz von fast
9 %, deuten darauf hin, dass auch für Westdeutschland ein
gravierendes Schätzproblem besteht.
Dies gilt umso mehr, da die
Definition der Kinderlosigkeit zwischen Bevölkerungsstatistik
und Mikrozensus abweicht. Bei ersterem wird die biologische
Elternschaft (zumindest für die Mütter), bei letzterem die
soziale Elternschaft erfasst. Darauf weist z.B. Andreas TIMM in
dem Sammelband
Die Bildungsexpansion, herausgegeben von Andreas HADJAR
& Rolf BECKER, hin:
|
Die Veränderung des Heirats- und Fertilitätsverhaltens im
Zuge der Bildungsexpansion
"Die
lebenslange Kinderlosigkeit auf der Grundlage der
Geburtenstatistik zu schätzen, ist vor allem deshalb
problematisch, weil erstens ausschließlich für bestehende
Ehen die Geborenen nach der Geburtenfolge erhoben werden.
Die Geburtenfolge für Geburten außerhalb von Ehen wird
dagegen nicht erfasst. Damit werden Frauen nicht
berücksichtigt, die zum ersten Mal ein Kind bekommen und
nicht oder nicht mehr verheiratet sind. Und zweitens
werden Frauen nicht einbezogen, die geschieden oder
verwitwet sind und erneut heiraten. Somit wird
beispielsweise ein drittes Kind, das in einer zweiten Ehe
geboren wird, als erstes Kind in der bestehenden Ehe
gezählt. Dazu kommt noch, dass für die jüngeren
Alterskohorten die endgültige Kinderzahl noch nicht
erreicht ist, da viele der jungen Frauen aus biologischer
Perspektive noch Kinder bekommen können. Daher basiert das
spätere generative Verhalten auf Schätzungen und nicht auf
tatsächlich ermittelten Zahlen. Mit der Geburtenstatistik
können ebenfalls keine bildungsspezifischen Aussagen
gemacht werden, da Informationen über das Bildungsniveau
fehlen.
Bei den Analysen mit Mikrozensusdaten über das spätere
generative Verhalten muss bedacht werden, dass keine
Angaben zu den von einer Frau geborenen Kindern abgefragt
werden. Im Mikrozensus gibt es ausschließlich Angaben über
im Haushalt lebende Kinder. Hinzu kommt, dass nicht
zwischen leiblichen und nicht leiblichen Kindern
differenziert wird. Als kinderlos werden also nicht nur
tatsächlich kinderlose Frauen gerechnet, sondern auch
Frauen, deren Kinder den Haushalt schon verlassen haben."
(Andreas Timm, 2006, S.287) |
Das Schätzverfahren, das
DORBRITZ für den Mikrozensus beschreibt, erscheint nur auf den
ersten Blick viel versprechend. Auf den zweiten Blick wird
deutlich, dass der Tiefstwert keinesfalls identisch mit dem
Anteil der lebenslang Kinderlosen sein muss. Es ist eher davon
auszugehen, dass der Tiefstwert bestenfalls den möglichen
Höchstwert der lebenslangen Kinderlosigkeit erfassen kann. Die
tatsächliche Kinderlosigkeit kann dagegen deutlich unter dem
angenommenen Tiefstwert liegen. Verschiebungen im Verhältnis
von Früh- und Spätgebärenden haben auch Einfluss auf dieses
Schätzverfahren. Es muss sogar davon ausgegangen werden, dass
durch die enorme Zunahme der Spätgebärenden in den westdeutschen
Geburtsjahrgängen Mitte der 1960er Jahre dieses Schätzverfahren
besondere Nachteile aufweist. Die Kinder der Frühgebärenden
könnten im vermehrten Maße bereits ausgezogen sein, bevor die
Spätgebärenden ihre Kinder bekommen. DORBRITZ gelingt es
jedenfalls nicht das Schätzproblem klein zu reden.
Björn
SCHWENTKER versucht im Zeit-Artikel Jede hat einen
guten Grund vom 22. Juni 2006 eine Annäherung an das
Phänomen einer Kultur der Kinderlosigkeit:
|
Jede hat einen guten Grund
"Anders als
der ökonomische Erklärungsversuch führt die soziologische
»Theorie des zweiten demografischen Übergangs« den neueren
Geburtenrückgang vor allem auf einen Wertewandel in der
Gesellschaft zurück. Ein gesteigerter Individualismus, das
höhere Konsumbedürfnis oder der steigende Wert der
Freizeit werden als Ursachen gesehen.
Die öffentliche Debatte schuf daraus eine »Kultur der
Kinderlosigkeit«, in der Nachwuchs keinen Wert mehr hat.
Gibt es die wirklich? »Wir haben im Moment einen Diskurs,
der zum Großteil aus Mythen besteht, für die es keine
kausalen Zusammenhangsbelege gibt«, sagt Gerda Neyer,
Politologin und Mathematikerin vom Max-Planck-Institut
(MPI) für demografische Forschung in Rostock. Auch die
Kultur-Theorie des neueren Geburtenrückgangs ist nie
kausal belegt worden. Das geht auch gar nicht. »Es ist
fast unmöglich, in solchen Zusammenhängen Ursache und
Wirkung auseinander zu halten«, sagt Gerda Neyer."
(Die Zeit 22.06.2006) |
Selbst wenn es den
Wertewandel gibt und dieser Auswirkungen auf die Geburtenrate
gehabt hat, so bleibt in der Debatte um die "Kultur der
Kinderlosigkeit" völlig unberücksichtigt, dass es
bereits seit Ende der 1980er Jahre einen Wandel des
Wertewandels gibt, der mittlerweile auch von
Lifestyle-Soziologen wie Stefan HRADIL eingestanden wird
 .
Die
Speerspitze dieses Wertewandels ist ausgerechnet die
Single-Generation. Spätestens seit den Romanen Ausweitung
der Kampfzone und Elementarteilchen von Michel
HOUELLEBECQ ist dieser Wandel nicht mehr zu leugnen. Vor kurzem
haben selbst die Grünen das Zurück zur traditionellen
Familie eingeläutet. Wenn sich dieser Wandel noch nicht so
deutlich an der Geburtenrate ablesen lässt, dann muss dies
keinesfalls an einer dramatischen Zunahme der lebenslang
Kinderlosen liegen, sondern an den Mängeln der deutschen
Geburtenstatistik und den veralteten Methoden der deutschen
Bevölkerungswissenschaftler. .
Die
Speerspitze dieses Wertewandels ist ausgerechnet die
Single-Generation. Spätestens seit den Romanen Ausweitung
der Kampfzone und Elementarteilchen von Michel
HOUELLEBECQ ist dieser Wandel nicht mehr zu leugnen. Vor kurzem
haben selbst die Grünen das Zurück zur traditionellen
Familie eingeläutet. Wenn sich dieser Wandel noch nicht so
deutlich an der Geburtenrate ablesen lässt, dann muss dies
keinesfalls an einer dramatischen Zunahme der lebenslang
Kinderlosen liegen, sondern an den Mängeln der deutschen
Geburtenstatistik und den veralteten Methoden der deutschen
Bevölkerungswissenschaftler.
Im
Buch Die Single-Lüge von Bernd KITTLAUS wird aufgezeigt,
dass die Single-Rhetorik den Geburtenrückgang negativ
beeinflusst hat. Der Bericht Die demographische Lage in
Deutschland 2005 von Evelyn GRÜNHEID liefert neue Indizien
dafür. Es wird z.B. deutlich, dass Bundestagswahlen, die mit
einer verstärkten Single-Rhetorik einhergehen, das
Gebärverhalten negativ beeinflussen. Potenzielle Eltern
(Singles) werden dadurch abgeschreckt
 .
Wenn das Single-Dasein an
Attraktivität gewonnen hat, dann liegt das weniger an der
tatsächlichen Zunahme der Alleinlebenden, sondern am rasanten
Aufmerksamkeitsschub, den Singles in den 1990er Jahren erhielten.
Seit Anfang der 1990er Jahren kann man in allen Medien lesen, dass
jeder Dritte, in Großstädten gar jeder Zweite allein lebt.
Tatsächlich lebt noch nicht einmal jeder fünfte Erwachsene
allein. Selbst der Anteil der Single-Haushalte, für den Ulrich
BECK 1990 einen Anstieg auf 70 % in Großstädten prophezeite, hat
sich nicht bewahrheitet. Dazu schreibt Evelyn GRÜNHEID: .
Wenn das Single-Dasein an
Attraktivität gewonnen hat, dann liegt das weniger an der
tatsächlichen Zunahme der Alleinlebenden, sondern am rasanten
Aufmerksamkeitsschub, den Singles in den 1990er Jahren erhielten.
Seit Anfang der 1990er Jahren kann man in allen Medien lesen, dass
jeder Dritte, in Großstädten gar jeder Zweite allein lebt.
Tatsächlich lebt noch nicht einmal jeder fünfte Erwachsene
allein. Selbst der Anteil der Single-Haushalte, für den Ulrich
BECK 1990 einen Anstieg auf 70 % in Großstädten prophezeite, hat
sich nicht bewahrheitet. Dazu schreibt Evelyn GRÜNHEID:
|
Die demographische Lage in Deutschland 2005
"Der
Anteil der Haushalte, die sich in Großstädten mit mehr als
100.000 Einwohnern befinden, hat sich seit 1991 verringert.
Hier haben sich die erheblichen Strukturveränderungen
zugunsten kleinerer Haushalte - vor allem in den
westdeutschen Großstädten - bereits vor 1991 vollzogen."
(aus: Zeitschrift für
Bevölkerungswissenschaft, Heft 1, 2006, S.83) |
Auch die These vom
Single als Pionier des flexiblen Kapitalismus ist in erster
Linie ein Mythos. Im Familienlebensalter lebte 2003 noch nicht
einmal jede 10. Frau, aber jeder 5. Mann allein. Nicht der
familienfreie männliche Single, sondern der familienfreie
Ehemann ist aber das Ideal der Wirtschaft
 .
Der Anstieg der
Alleinlebenden im mittleren Lebensalter ist des Weiteren kein Phänomen der
1990er Jahre, sondern lässt sich bereits seit Anfang der 1970er
Jahre nachweisen .
Der Anstieg der
Alleinlebenden im mittleren Lebensalter ist des Weiteren kein Phänomen der
1990er Jahre, sondern lässt sich bereits seit Anfang der 1970er
Jahre nachweisen
 . .
Das Schaubild zeigt, dass
sich der Anteil der allein lebenden 35-44 jährigen Frauen
vergleichsweise kontinuierlich über einen sehr langen Zeitraum vollzogen hat.
Dagegen hat sich der Anteil der allein lebenden Männer dieser
Altersgruppe in den 1990er Jahren stärker erhöht. Die
Familienpolitik hätte also bereits in den 1970er und 1980er Jahren
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf die Agenda
setzen müssen. Dies wurde versäumt.
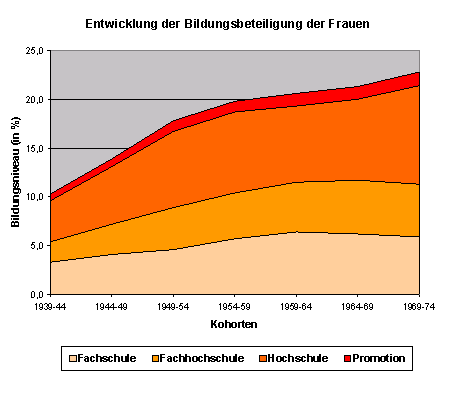 |
|
Quelle: Andreas Timm (2006,
S.279) |
|
Die
Karrierefrauen der Generation Golf (1965 - 1975 Geborene) haben nur ein Muster
fortgesetzt, das bereits durch die Single-Generation
(1948 - 1964 Geborene)
vorgelebt wurde
 . Aber selbst im Jahr 2003 lebten kaum mehr als
10 % der 35-44jährigen Frauen allein (weder muss es sich dabei
um Karrierefrauen, noch um Kinderlose handeln . Aber selbst im Jahr 2003 lebten kaum mehr als
10 % der 35-44jährigen Frauen allein (weder muss es sich dabei
um Karrierefrauen, noch um Kinderlose handeln
 ). Geht man von ca.
25 % lebenslang Kinderlosen aus, so ist diese
Zunahme der Kinderlosen keinesfalls durch den Anstieg der allein lebenden Frauen
erklärbar. Es bleiben deshalb nur zwei Erklärungen: entweder
ist der Anteil der Kinderlosen weit geringer oder die
Kinderlosen sind nicht unter den allein lebenden Karrierefrauen
zu suchen. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo zwischen diesen
beiden Deutungen ). Geht man von ca.
25 % lebenslang Kinderlosen aus, so ist diese
Zunahme der Kinderlosen keinesfalls durch den Anstieg der allein lebenden Frauen
erklärbar. Es bleiben deshalb nur zwei Erklärungen: entweder
ist der Anteil der Kinderlosen weit geringer oder die
Kinderlosen sind nicht unter den allein lebenden Karrierefrauen
zu suchen. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo zwischen diesen
beiden Deutungen
 . .
Bei
der Debatte um die Kultur der Kinderlosigkeit wird übersehen,
dass der Anteil der kinderreichen Familien ein
bedeutender Faktor des Babybooms der 1960er Jahre war. In seinem
Gutachten Nachhaltige Familienpolitik aus dem Jahr 2005 hat der
Soziologe Hans BERTRAM auf diesen vernachlässigten Sachverhalt
hingewiesen:
|
Nachhaltige Familienpolitik
"Es
ist gut nachvollziehbar, dass der Anstieg der
Kinderlosigkeit seit Anfang der 70er Jahre (...) als
zentrale Ursache für den Geburtenrückgang in Deutschland
(...) angesehen wird. Aber auch andere Länder - wie etwa
die USA mit einer Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau
(...) oder Finnland mit etwa 1,8 Kindern pro Frau (..) -
verzeichnen eine hohe Kinderlosigkeit von 10 bis 22
Prozent. (...).
Die
hohen Geburtenraten in der Zeit des Babybooms in den 60er
Jahren sind im Wesentlichen auf die hohe Zahl der
Mehrkinderfamilien zurückzuführen. (...).
Der
Geburtenrückgang in Deutschland ist (...) Ergebnis des
zunehmenden Verschwindens der Mehrkinderfamilie."
(2005, S.10)
"Die
Diskussion um den Geburtenrückgang wird in der Regel auf
der Basis von Durchschnittswerten geführt, indem etwa die
Geburtenrate von 1970 (2,2) mit der Geburtenrate von 2003
(1,39) verglichen wird. Hinter diesen Durchschnittswerten
verbergen sich aber nicht nur ganz unterschiedliche
Lebensformen ohne und mit Kindern, sondern es gibt auch
bei den familiären Lebensformen mit Kindern Ein-, Zwei,
Drei- Vier- und Mehrkinderfamilien, was als Tatbestand in
der öffentlichen Debatte kaum thematisiert wir. So spricht
Kaufmann (2000) von einer Polarisierung zwischen den
Erwachsenen, die sich für Kinder entscheiden und
denjenigen, die das nicht tun. Auch Rürup (2003) geht in
seiner Definition der nachhaltigen Familienpolitik davon
aus, dass die Entscheidung für ein Kind quasi automatisch
eine mögliche Entscheidung für ein zweites Kind ist und
möglicherweise weitere Kinder nach sich zieht, unabhängig
von anderen Faktoren. Diese Debatte erinnert ein wenig an
die Diskussion der 50er und 60er Jahre, als die Frauen,
die sich für Kinder und Beruf entschieden, als Rabenmütter
etikettiert wurden, weil die »guten« Mütter sich »nur« um
ihre Kinder zu kümmern hatten."
(2005, S.27)
|
Die Instrumentalisierung internationaler
Vergleiche
Kommen wir nochmals auf
den anfangs zitierten Artikel von Inge KLOEPFER zurück. Darin
wird behauptet, dass einzig Deutschland mit einem Problem hoher
Kinderlosigkeit zu kämpfen hat. Die Ausführungen von Jürgen
DORBRITZ lassen dagegen andere Schlüsse zu:
|
Kinderlosigkeit in Deutschland und Europa - Daten, Trends
und Einstellungen
"Für
insgesamt 28 Länder in Europa sind Daten verfügbar.
Berechnet wurde die Kinderlosigkeit nur für die Länder, in
denen die Lebendgeborenenfolge nach der biologischen
Rangordnung vorliegt. (...). Aufgrund der (...) Probleme
wurden durch das ODE für Deutschland und auch für die
Schweiz keine Daten veröffentlicht."
(aus:
Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Heft 4, 2005,
S.372)
"Es gilt aber
nach wie vor, dass Westdeutschland und die Schweiz die
Vorreiter hinsichtlich der Ausweitung der Kinderlosigkeit
waren und auch heute noch die höchsten Werte in Europa
verzeichnen."
(aus:
Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Heft 4, 2005,
S.373)
"Der
Geburtsjahrgang 1966 in Westdeutschland wird
voraussichtlich zu 29,1 % und der Geburtsjahrgang 1963 in
der Schweiz zu 27,9 % kinderlos bleiben."
(aus:
Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Heft 4, 2005,
S.376)
"Höpflinger hatte bereits 1991 (97) die Frage nach der
Kinderlosigkeit als Lebensstil gestellt, die Antwort aber
negativ ausfallen lassen (...). Heute, nur wenige Jahre
später, ist eine eindeutig andere Antwort zu geben, auch
wenn man (noch) nicht vom europäischen Lebensstil der
Kinderlosigkeit sprechen kann. Das gilt nur für wenige
Länder, in denen Kinderlosigkeit sehr früh aufgetreten ist
und eine starke Verbreitung gebunden hat. In erster Linie
sind das Westdeutschland und die Schweiz, aber auch
Österreich, England/Wales und Irland sind dieser
Ländergruppe zuzurechnen. (...). Tatsächliche
Polarisierungsituationen, wo sich in den
Geburtsjahrgängen, die sich zur Zeit dem Ende des
gebärfähigen Alters nähern, Kinderlose und Familien in
einer ein Drittel/zwei Drittel-Größenordnung gegenüber
stehen, findet man aber nur in der Schweiz und in
Westdeutschland."
(aus:
Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Heft 4, 2005,
S.378)
"Ein
eindeutiger Zusammenhang zwischen Kinderlosigkeit und
endgültiger Kinderzahl besteht nicht (...). Der am ehesten
erwartete Zusammenhang, eine hohe Kinderlosigkeit ist mit
einer sehr niedrigen Geburtenhäufigkeit verknüpft, trifft
nur für wenige Länder zu (Westdeutschland, Schweiz,
Italien, Österreich)"
(aus:
Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Heft 4, 2005,
S.381)
"Im
Trend (...) gilt, je höher die Kinderlosigkeit ist, desto
niedriger ist die endgültige Kinderzahl. (...).
Andererseits findet man Länder (Irland, Finnland,
England/Wales, Niederlande), in denen eine hohe
Kinderlosigkeit von einem relativ hohen Geburtenniveau
begleitet wird. Eine solche Situation kann nur eintreten,
wenn es neben den Kinderlosen einen relativ hohen Anteil
an Familien gibt, die drei oder mehr Kinder haben."
(aus:
Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Heft 4, 2005,
S.382f.) |
Aus den Ausführungen von
DORBRITZ lässt sich - im Gegensatz zu den Behauptungen von
KLOEPFER - folgendes ableiten: (West-)Deutschland ist noch nicht
einmal in Westeuropa ein Sonderfall, sondern gehört zusammen mit
der Schweiz, Italien und Österreich zu jenen Ländern, bei denen
eine relativ hohe Kinderlosigkeit mit einem niedrigen Anteil von
kinderreichen Familien einher geht. Ausgerechnet die beiden
Länder, denen der höchste Anteil Kinderloser zugeschrieben wird,
haben eine Geburtenstatistik, die eine eindeutige Zuordnung von
Kindern zu Frauen nicht zulässt.
Während weder in der Schweiz
noch in Italien die hohe Kinderlosigkeit zu derart heftigen
Debatten geführt haben wie in Deutschland, ist in Österreich
ebenfalls die Debatte um eine Kultur der Kinderlosigkeit
entbrannt, wie der Pressemeldung Kultur der Kinderlosigkeit.
Österreich beim Kinderwunsch europäisches Schlusslicht der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften vom 19. Dezember
2006 zu entnehmen ist:
|
Kultur der Kinderlosigkeit. Österreich beim Kinderwunsch
europäisches Schlusslicht
"Neueste Daten
des Eurobarometers 2006 zeigen, dass österreichische
Frauen und Männer die niedrigsten Kinderwünsche in Europa
haben. Besonders bei den jüngeren Männern sagen mehr als
ein Drittel, dass sie gar keine Kinder wollen. Lag vor
zehn bis 15 Jahren die persönlich als ideal angesehene
Kinderzahl noch bei über zwei Kindern, so beträgt sie
heute im Durchschnitt nur noch 1,6 Kinder. Diese Daten
können Vorzeichen einer weiteren deutlichen Abnahme der
Geburtenzahl in Österreich sein.
Eine mögliche
Erklärung für diese jüngste Abnahme des Kinderwunsches in
Österreich und in den anderen deutschsprachigen Ländern
kann die so genannte »Low Fertility Trap Hypothese«
bieten. Diese am Wiener Institut für Demographie der ÖAW
und dem Internationalen Institut für angewandte
Systemforschung (IIASA) in Laxenburg entwickelte Hypothese
besagt, dass der Kinderwunsch junger Menschen durch die
Zahl der Kinder, die sie in ihrer Umgebung und den Medien
erleben und sehen, beeinflusst wird. Erleben sie nur
wenige Erwachsene mit Kindern, so spielen auch Kinder für
ihre eigenen Lebensziele eine geringere Rolle. Es
entwickelt sich eine Kultur der geringen Kinderzahl bzw.
Kinderlosigkeit." |
Die "Low Fertility Trap
Hypothese" wurde in Deutschland durch das Buch Minimum
von Frank SCHIRRMACHER popularisiert. Um diesem Horrorszenario
den nötigen Nachdruck zu verschaffen, schreckten Journalisten
der Welt noch nicht einmal davor zurück, falsche
Geburtenzahlen für das Jahr 2005 in Umlauf zu bringen
 .
Damit sind wir bei der
aktuellen Debatte angelangt, denn der von KLOEPFER zitierte
Ifo-Forscher Martin WERDING trat bereits im Jahr 2003 für eine Rente nach Kinderzahl ein. Die Polarisierungsthese, die
den Hauptkonflikt zwischen Eltern und Kinderlosen sieht, eignet
sich besonders gut, um drastische Bestrafungen von Kinderlosen
zu fordern.
Vera GASEROW sieht in der
Frankfurter Rundschau auf Kinderlose
neue gravierende Benachteiligungen zukommen: .
Damit sind wir bei der
aktuellen Debatte angelangt, denn der von KLOEPFER zitierte
Ifo-Forscher Martin WERDING trat bereits im Jahr 2003 für eine Rente nach Kinderzahl ein. Die Polarisierungsthese, die
den Hauptkonflikt zwischen Eltern und Kinderlosen sieht, eignet
sich besonders gut, um drastische Bestrafungen von Kinderlosen
zu fordern.
Vera GASEROW sieht in der
Frankfurter Rundschau auf Kinderlose
neue gravierende Benachteiligungen zukommen:
|
Der Druck auf die Kinderlosen wächst
"In der Debatte um die
Zukunft der sozialen Sicherungssysteme ist (die)(...)
Sonderstellung von Kinderlosen bereits Realität.
Die zentrale Weiche dafür hat 2001 das
Bundesverfassungsgericht gestellt mit seinem Urteil zur
Pflegeversicherung. (...). Seit 2005 zahlen deshalb rund
drei Millionen Kinderlose ein viertel Prozent mehr in die
Pflegekasse als Väter und Mütter - egal, ob deren Fürsorge
für die Kinder nur auf dem Papier steht oder sie weit
besser betucht sind als viele Singles.
Das Vorbild der Pflegeversicherung -
darauf dringen jetzt vor allem Unionspolitiker - soll auch
auf die Rentenversicherung übertragen werden, in weit
stärkerem Umfang."
(FR 18.01.2007) |
Fazit: Die Kultur der Kinderlosigkeit ist ein
Kampfbegriff derjenigen, die eine Spaltung der Gesellschaft
entlang der Kinderfrage betreiben
Die Rede von einer Kultur der
Kinderlosigkeit nimmt die Kinderlosen ins Visier. Kinderlosen
wird nach dieser Lesart die Hauptschuld am Geburtenrückgang -
und damit an Wohlstandsverlusten und den Problemen mit den
sozialen Sicherungssystemen - zugeschrieben.
Die Spaltung in Eltern und Kinderlose soll dadurch
institutionalisiert werden, z. B durch eine Rente nach
Kinderzahl oder gar durch ein Elternwahlrecht. Wie jedoch gezeigt wurde, ist
zum einen das Ausmaß der lebenslangen Kinderlosigkeit in
Deutschland unbekannt. Die Schätzungen divergieren bereits beim
westdeutschen Geburtenjahrgang 1965 um fast 9 %. Zum anderen ist
die Hauptursache des Geburtenrückgangs die Abnahme der
kinderreichen Familien.
Länder wie Irland und Finnland zeigen,
dass eine hohe Geburtenrate mit hoher Kinderlosigkeit einher
gehen kann. Polarisierungen müssen also weder zu
gesellschaftlichen Spaltungen noch zu drastischen
Geburtenrückgängen führen.
Es muss deshalb gefragt
werden, warum ausgerechnet in Deutschland - im Gegensatz zu
anderen Ländern mit hoher Kinderlosigkeit - ein tiefer Graben
entstanden ist. Im Buch Die Single-Lüge wird aufgezeigt,
dass der Kulturkampf zweier Eliten dazu geführt hat, dass
sich eine moderne Familienpolitik nicht durchsetzen konnte.
Stattdessen führte die
Single-Rhetorik in Politik, Wissenschaft und Medien dazu, dass
Singles sich ihrer Lage nicht bewusst werden konnten. Es konnten
zwar - wie beabsichtigt - die Eltern mobilisiert werden,
andererseits wirkte die Single-Rhetorik jedoch auf potenzielle
Eltern abschreckend. Wenn angeblich jeder Zweite allein lebt,
dann kann doch Elternschaft nicht erstrebenswert sein. Dass
jedoch nicht einmal jeder fünfte Erwachsene allein lebt und
zudem das Single-Dasein vor allem in der ersten Lebenshälfte nur
eine Lebensphase, aber keine Alternative zum Paar oder zur
Familie ist, das blieb in der Debatte unbeachtet. Wir haben es
somit mit einem Versagen unserer Eliten in Politik, Wissenschaft
und Medien zu tun.
Kinderlose sollen nun die
Zeche zahlen. Während jedoch den kinderlosen Eliten zahlreiche
Exitoptionen zur Verfügung stehen, werden die kinderlosen
Modernisierungsverlierer - darunter vor allem männliche Singles
- besonders von den veränderten Bedingungen betroffen werden.
Wie weiter oben gezeigt wurde, ist der Anteil der
Singlemänner im Familienalter in den 90er Jahren besonders
gestiegen. Die Konsequenzen dieser Strukturveränderungen in den
Single-Haushalten sind bislang in der Debatte, die sich
hauptsächlich um allein lebende Karrierefrauen drehte,
unterbelichtet geblieben. Im Buch Die Single-Lüge wird
auf dieses vernachlässigte Problem näher eingegangen. Die
Debatte um eine Kultur der Kinderlosigkeit in Deutschland geht
am Kern des Problems vorbei.
|
Die Single-Lüge - Das Buch zur Debatte
 "Dies
ist die erste grundlegende Auseinandersetzung mit dem
nationalkonservativen Argumentationsmuster, das zunehmend
die Debatte um den demografischen Wandel bestimmt.
Hauptvertreter dieser Strömung sind Herwig Birg, Meinhard
Miegel, Jürgen Borchert und Hans-Werner Sinn. Die
Spannbreite der Sympathisanten reicht von Frank
Schirrmacher bis zu Susanne Gaschke. Als wichtigster
Wegbereiter dieses neuen Familienfundamentalismus muss der
Soziologe Ulrich Beck angesehen werden. "Dies
ist die erste grundlegende Auseinandersetzung mit dem
nationalkonservativen Argumentationsmuster, das zunehmend
die Debatte um den demografischen Wandel bestimmt.
Hauptvertreter dieser Strömung sind Herwig Birg, Meinhard
Miegel, Jürgen Borchert und Hans-Werner Sinn. Die
Spannbreite der Sympathisanten reicht von Frank
Schirrmacher bis zu Susanne Gaschke. Als wichtigster
Wegbereiter dieses neuen Familienfundamentalismus muss der
Soziologe Ulrich Beck angesehen werden.
Es wird aufgezeigt, dass sich die
nationalkonservative Kritik keineswegs nur gegen Singles
im engeren Sinne richtet, sondern auch gegen Eltern, die
nicht dem klassischen Familienverständnis entsprechen." |
|
|
| |
|
|
|
|