| |
Einführung
Ein Blick in die Vergangenheit der Zukunft
Deutschlands bietet die Möglichkeit die Grenzen von
Bevölkerungsvorausberechnungen zu erkennen. Welche Zukünfte
wurden uns Deutschen prophezeit und was ist davon überhaupt
eingetreten? Diese Bibliografie ermöglicht einen Vergleich
zwischen zeithistorischen Befürchtungen bezüglich des
demografischen Wandels und der tatsächlichen Entwicklung in
Deutschland.
Kommentierte Bibliografie (Teil 4: 2011 -
2013)
2011
OFFERGELD,
Silke (2011): In Deutschland droht der Pflegekollaps.
Experten warnen vor der
steigenden Zahl der Dementen - Wenn die Alten für die noch
Älteren sorgen müssen,
in: Kölner Stadt-Anzeiger v. 06.01.
ZIMMERMANN, Klaus F.
(2011): Die Zukunft der Arbeit.
Keine
Sorge, die Jobs gehen uns nicht aus. Doch die Berufswelt
verändert sich stark. Zehn Thesen,
in: Süddeutsche Zeitung v. 08.01.
Der umstrittene Präsident des DIW trägt das seit den 1970er
Jahren immerwährende Mantra der Ökonomen vor: es mangelt in
Zukunft an Arbeitskräften. Als Beispiel eine kleine Kostprobe
für die Treffsicherheit von DIW-Bevölkerungsvorausberechnungen,
die ja die Grundlage für Vorhersagen der
Arbeitskräfteentwicklung sind.
Unser
Papst in Sachen Bevölkerungsvorausberechnung, der
Bevölkerungswissenschaftler Herwig BIRG hat im
DIW-Wochenbericht Nr.24/1981 eine Vorausberechnung bis zum
Jahr 2030 auf der Basis der Daten von 1980 vorgelegt.
Für das Jahr 2000 hat Herwig
BIRG eine Untergrenze von 59,1 Millionen und eine Obergrenze von
62,4 Millionen errechnet. Der tatsächliche Bevölkerungstand auf
dem Territorium der Bundesrepublik betrug im Jahr 2000 jedoch
67,2 Millionen. Dumm gelaufen kann man da nur sagen. In nur 20
Jahren um 5 Millionen Menschen verschätzt. Natürlich konnte
unser Bevölkerungspapst den Mauerfall nicht vorhersehen. Aber
bei allen Bevölkerungsvorausberechnungen gab es unvorhergesehene
Ereignisse, die Neuberechnungen erforderlich machten. Allein im
Zeitraum 1970 bis 1980 musste das DIW seine
Bevölkerungsvorausberechnungen 5 Mal korrigieren!
Ausgerechnet jetzt soll das
anders werden? Ausgerechnet jetzt soll es keine unvorhersehbare
Ereignisse mehr geben? Von heute auf morgen könnten die
Geburtenzahlen explodieren und zwar nicht, weil die Geburtenrate
steigt, sondern weil die Frauen den Zeitpunkt ihrer Geburten
ändern. Es liegen keinerlei Berechnungen für diesen Fall vor,
weil das Gebärverhalten in den letzten Jahren scheinbar eine
Konstante war, die einer Naturkonstanten entspricht.
Es könnte auch ein Einbruch bei
der Lebenserwartung geben, den sich heutzutage kein Mensch
vorstellen kann. Aber in den zurückliegenden Jahrhunderten
traten immer unerklärliche Vorgänge ein, die man sich erst im
Nachhinein erklären musste.
Alle Vorausberechnungen haben
den Nachteil, dass sie die Zukunft aus Entwicklungen der
Vergangenheit erklären und so tun, als ob diese Entwicklungen
sich fortsetzen. Diesen Gefallen tun die Entwicklungen aber
nicht.
Unsere Ökonomen sind noch
nicht einmal in der Lage den Bedarf an Kindertagesstätten auf
Zeiträume von weniger als 5 Jahren richtig einzuschätzen.
Müssten die Ökonomen bei
jeder Prognose die Fehleinschätzungen ihrer vergangenen
Prognosen vortragen, dann wären sie auf alle Fälle vorsichtiger.
Also Herr ZIMMERMANN erzählen Sie uns bitte, was Sie vor 5, vor
10 Jahren über die Arbeitswelt von 2010 erzählt haben. Bevor
dies nicht getan ist, sollte jedem Ökonomen verboten werden,
über die Zukunft zu schwafeln. Man kann sicher sein, die
Wortmeldungen von Ökonomen würden rapide abnehmen. Wir könnten
uns dann wichtigeren Dingen zuwenden...
TV-Film 2030 - Aufstand der Jungen (Januar 2011)
BRYANT, Thomas (2011): Alterungsangst und Todesgefahr.
Der deutsche
Demografie-Diskurs (1911-2011)
in: Aus Politik und Zeitgeschichte Nr.10-11 v. 07.03.
Der Historiker Thomas
BRYANT zeichnet die 100jährige Debatte zum demografischen
Wandel nach, in der des Öfteren die Gefahr der "Vergreisung"
und des "Aussterbens" beschwört worden ist.
Die Debatte um den Geburtenrückgang als Ursache dieser
gefährlichen Entwicklung setzt um das Jahr 1911 ein:
"1911 ist
gewissermaßen das Stichjahr für die Diskussion über die
demografische Alterung in Deutschland. Es war der Gynäkologe
Max Hirsch, der in jenem Jahr einen Aufsatz unter dem Titel
»Der Geburtenrückgang - Etwas über seine Ursachen und die
gesetzgeberischen Maßnahmen zu seiner Bekämpfung«
veröffentlichte. Auch wenn der Begriff »Geburtenrückgang«
hier erstmals im Titel einer Veröffentlichung auftauchte, so
gab es bereits schon zuvor einige andere Autoren, die sich
gleichermaßen mit diesem Gegenstand auseinandergesetzt
hatten."
Unter der Formel
"Deutschland in Gefahr" fasst BRYANT die Debatte der Jahre
1911 - 1945 zusammen, in der Nationalökonomen wie Lujo
BRENTANO oder Julius WOLF ("Der Geburtenrückgang"), Mediziner,
Hygieniker und vor allem der Bevölkerungswissenschaftler
Friedrich BURGDÖRFER die Entwicklungen beschrieben bzw. wie
letzterer populärwissenschaftlich anheizten:
"Mit seinem 1932
veröffentlichten Hauptwerk »Volk ohne Jugend« verhalf
Burgdörfer diesem Diskurs endgültig zum Durchbruch, indem er
»die drohende Schrumpfung und Überalterung des Volkskörpers«
aufs Schärfste verurteilte und sich zugleich energisch für
eine »volkserneuernde, volkserhaltende Familienpolitik«
aussprach, um so die »biologische Selbstvernichtung« des
deutschen Volkes abzuwenden.
Nach der »Machtergreifung« der Nationalsozialisten 1933
stiegen demografische Themen in den Rang eines zentralen,
gesamtgesellschaftlichen Politikums auf."
Was heutzutage gerne
verdrängt wird: im goldenen Zeitalter von Ehe und Familie,
also den 1950er Jahren, wurde das Aussterben beschworen. Ganz
im Gegensatz zum gegenwärtigen Mythos, wonach Konrad ADENAUER
zugeschrieben wird, dass Frauen Kinder immer kriegen, sah das
1953 ganz anders aus:
"Hervorzuheben ist in
diesem Zusammenhang die Gründung eines Bundesministeriums
für Familienfragen im Herbst 1953. Bundeskanzler Konrad
Adenauer rechtfertigte dieses institutionelle Novum damit,
dass »die wachsende Überalterung des deutschen Volkes«
gefährlich und »die Bevölkerungsbilanz des deutschen Volkes
(...) erschreckend« sei. Sein zuständiger Fachminister
Franz-Josef Wuermeling malte gar das altbekannte
Schreckgespenst vom »allmähliche(n) Aussterben unseres
Volkes« an die Wand."
Den Nachkriegsdiskurs
nennt BRYANT "Deutschland ohne Deutsche". Erstaunlicherweise
liest man jedoch bei BRYANT, dass die Debatte erst wieder in
den 1980er Jahren entflammt. Dies steht jedoch im Widerspruch
zur Tatsache, dass bereits in den 1970er Jahren entscheidende
Weichenstellungen vorgenommen werden (Gründung
des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung 1973) und
gerade auch im
Hinblick auf die Rentenpolitik eine öffentliche Debatte
forciert wurde (auch
hier). Dagegen wird die Debatte seit der Wiedervereinigung
von BRYANT unter das schillernde Motto "Deutschland gegen
Methusalem" gestellt, was einer Verengung der Debatte auf die
Kontroverse um das Methusalem-Komplott (Frank
SCHIRRMACHER) geschuldet ist. Für BRYANT ist für diese Phase
ein Schwanken zwischen zwei Extrempositionen charakteristisch.
Entscheidender ist jedoch, dass mit dem demografischen Wandel
die Agenda 2010 gerechtfertigt wurde, die das Verhältnis
zwischen Kapital und Arbeit einseitig zu Lasten der
Arbeitnehmer verändert hat.
"Ungeachtet dieser
Ambivalenz bleibt festzuhalten, dass der diskursive
Schwerpunkt nach wie vor eindeutig auf den »Gefahren« des
demografischen Wandels liegt - vorrangig im Bereich der
staatlichen Wohlfahrtspolitik. Die letztgenannte Sichtweise
offenbarte sich auch 2003 in einer Rede des damaligen
SPD-Fraktionsvorsitzenden Franz Müntefering: »Wir
Sozialdemokraten haben in der Vergangenheit die drohende
Überalterung unserer Gesellschaft verschlafen. Jetzt sind
wir aufgewacht. Unsere Antwort heißt:
Agenda 2010!
Die Demografie macht den Umbau unserer Sozialsysteme
zwingend notwendig.«"
Kritische
Sozialwissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von
einer
"Demographisierung sozialer Probleme" bzw.
"Demographisierung des Gesellschaftlichen". In der
Schlussbetrachtung geht BRYANT auf Thilo SARRAZINs Bestseller
Deutschland schafft sich ab ein, den er als Vorbote
weiterer "Erbwalter" einer bedenklichen nationalen Tradition
einstuft. Vor diesem Hintergrund ist jedoch die Einschätzung
von BRYANT, dass der Begriff "demografischer Wandel" zur
Versachlichung der Debatte beigetragen hat, selber
ideologisch. BRYANT behauptet, dass dadurch die Chancen der
"demografischen Alterung" diskutierbar geworden seien:
"Aufgrund der
demografischen Veränderungen im Zuge der deutschen
Wiedervereinigung richtete der Deutschen Bundestag eine
Enquête-Kommission ein, die sich ausführlich mit diesem
Thema auseinandersetzte. Der Kommission war es gelungen, die
ideologisch aufgeladenen Begriffe
»Vergreisung«
und »Volkstod« weitestgehend durch den
neutraleren Begriff »demografischer Wandel« - der sich
inzwischen mehrheitlich im allgemeinen Sprachgebrauch
durchgesetzt hat - zu ersetzen und damit zugleich auch den
Alterungsdiskurs insgesamt etwas zu versachlichen.
Ohne diesen semantischen Fortschritt wäre es um die
Jahrtausendwende wohl nicht zur Herausbildung eines gänzlich
neuen Diskursstranges gekommen, der nun erstmals nicht nur
einseitig die Gefahren und Nachteile thematisiert, sondern
ergänzend dazu auch die potenziellen Chancen und Vorzüge der
demografischen Alterung mit in Betracht zieht."
Inwiefern die
"potenziellen Chancen und Vorzüge" tatsächlich realisiert
werden können, ist jedoch die entscheidende Frage. Das
hervorragende Buch
Lebensqualität produzieren von Alban KNECHT zeigt
deutlich, dass mehr Lebensqualität für alle eine
Herausforderung darstellt, denn es besteht die
Gefahr, dass
in unserem konservativen Wohlfahrtsregime die Chancen des
demografischen Wandels ungenutzt bleiben.
PUSCHNER, Sebastian (2011): "Viele Länder sind uns demografisch
auf den Fersen."
Im Gespräch: Die deutsche Angst
vor dem Aussterben hat Tradition, sagt der Demografieforscher
Ralf Ulrich. Zuwanderung allein kann das Problem nicht mehr
lösen,
in: Freitag Nr.39 v. 29.09.
SOBOTKA,
Tomáš & Wolfgang LUTZ
(2010): Wie Politik durch falsche Interpretationen der
konventionellen Perioden-TFR in die Irre geführt wird: Sollten
wir aufhören, diesen Indikator zu publizieren?
CPOS-Thema:
Tempoeffekte in demografischen Periodenmaßen,
in: Comparative Population Studies, Heft 3
Tomáš SOBOTKA &
Wolfgang LUTZ befassen sich mit den Unzulänglichkeiten des
Indikators der durchschnittlichen Kinderzahl (TFR),
die bislang die politische Debatte um den demografischen
Wandel dominierte. Anhand von 4 Beispielen zeigen sie die
Problematik auf:
1) die vermutete Kluft
zwischen gewünschter und realisierter Kinderzahl
2) der aktuelle Anstieg der TFR in Europa
3) die Kinderzahl von Migrantinnen im Vergleich zu den
Einheimischen
4) der Zusammenhang zwischen Familienpolitik und
TFR-Änderungen
Letzter Punkt ist
besonders interessant, denn in der Debatte um das Elterngeld
dominierte lange Zeit Schweden als Musterland (inzwischen hat
Frankreich diese Rolle für andere Reformvorhaben übernommen).
Der schwedische "Babyboom" infolge des Elterngeldes galt
bisweilen als Rechtfertigungsgrund für die Einführung des
Elterngeldes auch in Deutschland. SOBOTKA & LUTZ weisen darauf
hin, dass der dortige Anstieg der TFR weniger eine Änderung im
Geburtenausmaß (Quantum), sondern vor allem eine Änderung im
Timing (Vorziehen von Geburten) und Geburtenabstand (zweite
und dritte Kinder folgen in einem kürzeren Abstand auf das
erste Kind) bewirkt hat.
SOBOTKA & LUTZ sehen für
Deutschland deshalb die
Gefahr, dass die TFR einen Babyboom (Änderung des Quantums)
vorgaukeln könnte, obwohl es sich nur um das Vorziehen von
Geburten handelt (Tempoeffekt).
VÖLPEL, Eva (2011): Schrumpfen und vergreisen.
Zukunft: Bis 2060 werden in Deutschland rund 17 Millionen
weniger Menschen leben, zeigt der Demografiebericht der
Bundesregierung. Vor allem Ostdeutschland ist betroffen,
in: TAZ v.
27.10.
Demografieberichte sind die Stunde der Schwarzmalerei. Von
rechts bis links liest man heute das, was das
Bundesinnenministerium vorgibt. Investigativer Journalismus?
Fehlanzeige! Dabei ist der Bericht alles andere als
stichhaltig.
1. Der Bericht beruht auf
Basisdaten von 2008. Dies entspricht der
12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, die am 18.
November 2009 veröffentlicht wurde. Angenommen wird im
Demografiebericht die Variante 1-W1 "mittlere Bevölkerung,
Untergrenze".
|
Stand: 31.12. |
Prognose (Bevölkerung
in Millionen) |
tatsächliche
Entwicklung (Bevölkerung in Millionen) |
| 2008 |
82,002 |
82,002 |
| 2009 |
81,735 |
81,802 |
| 2010 |
81,545 |
81,752 |
| 2011 |
81,374 |
März:
81,7 |
Bereits nach zwei Jahren
ist die Bevölkerungsentwicklung positiver verlaufen als in der
Variante, die im Demografiebericht als voraussichtliche
Entwicklung angenommen wird. Dabei wurden bereits in den
letzten Jahren Korrekturen nach unten vorgenommen, damit die
Volkszählungszahlen 2011 nicht zu sehr von der
Bevölkerungsfortschreibung abweichen.
2. In der Basisannahme wird
eine Geburtenhäufigkeit von 1,4 Kinder pro Frau angenommen.
Tatsächlich liegt aber die Geburtenhäufigkeit der Anfang der
1960er Jahre geborenen Frauen, die ihre endgültige
Kinderzahl erreicht haben zwischen 1,6 und 1,5. Nicht einmal der Jahrgang 1965 wird die Zahl von 1,5
unterschreiten. Auch bei den in den 1970er Jahren
geborenen Frauen ist dies nicht wahrscheinlich. Ob überhaupt
ein Frauenjahrgang die 1,4 unterschreitet ist nicht sicher.
3. Die Zahl der
Erwerbsfähigen ist stark abhängig von der Berechnung des
Altersquotienten. BOHSEM schreibt in der SZ:
"Kamen im vergangenen Jahr
34 Alte auf 100 Erwerbstätige wird sich dieses Verhältnis bis
2060 deutlich verändern - auf 67 auf 100".
Grundlage dafür ist eine
Altersgrenze von 65 Jahren. Bereits die Heraufsetzung der
Altersgrenze auf 67 Jahre bedeutet einen Rückgang von 67 auf
59 Rentner pro 100 Erwerbsfähige. Zudem kann der
Erwerbsfähigenanteil durch Verkürzung der Ausbildungszeiten
und einen früheren Einstieg ins Berufsleben erhöht werden.
4. Die Erwerbsfähigen
beinhalten viele Menschen, die dem Arbeitsmarkt gar nicht zur
Verfügung stehen, z.B. die offiziellen Arbeitslosen. Bei in
den letzten Jahren 7 Millionen Menschen, die dem Arbeitsmarkt
nicht zur Verfügung standen (Die amtliche Statistik rechnet
die tatsächliche Zahl - "Arbeitslose" genannt - klein),
bedeutet eine Verringerung dieser Menschen bis 2060 eine
Erhöhung der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden
Menschen.
Fakt ist: Der
Demografiebericht überschätzt den Einfluss der
Bevölkerungsentwicklung auf die Wirtschafts- und
Wohlstandsentwicklung gewaltig.
LUTZ, Martin (2011): Deutschland bleiben nur wenige Wachstumsinseln.
Bundesregierung legt erstmals Bericht zum demografischen
Wandel vor: 2060 gibt es voraussichtlich noch 65 Millionen Deutsche,
in: Welt v.
27.10.
BOHSEM, Guido (2011): Weniger, älter, einsamer.
Weil die Gesellschaft schrumpft, sollen vor allem
berufstätige Mütter und Jungendliche ohne Abschluss die Lücken auf dem
Arbeitsmarkt füllen,
in: Süddeutsche Zeitung v.
27.10.
PRANTL, Heribert (2011): Deutschland, ein Fliegenpilz.
Die Bundesrepublik braucht Einwanderung, sonst droht ein
gewaltiger Verlust an Vitalität,
in: Süddeutsche Zeitung v.
27.10.
Nur Zyniker wie Heribert
PRANTL sehen allen Ernstes die
Pyramidenform der Bevölkerung als Zeichen einer vitalen
Gesellschaft. Das Gegenteil ist der Fall: hohe Kinder-,
Jugend- und Erwachsenensterblichkeit ist die Grundlage der
Pyramide. Oder wie es Werner BRACHAT-SCHWARZ im
Statistischen Monatsheft Baden-Württemberg vom September
2011 schreibt:
"Die aktuelle Form,
oftmals als »kranke« Pyramide bezeichnet, hat sich nicht nur
wegen der anhaltend zu geringen Geburtenrate ergeben,
sondern auch weil die Lebenserwartung stark angestiegen ist.
Das heißt aber, dass die angeblich »kranken« Alterspyramiden
weder krank noch gesund sind. Dagegen spiegeln »gesunde«
Alterspyramiden eher eine kranke Bevölkerung wider, in der
Menschen frühzeitig sterben" (S.16)
STUTTGARTER ZEITUNG-Tagesthema:
Deutschland vergreist.
Demografen
warnen: Die Altersstruktur der Bevölkerung verschiebt sich
dramatisch. Betroffen sind vor allem ländliche Gebiete und der
Osten |
LINK, Christoph
(2011): Angst vor der großen Leere.
Demografie:
Der starke Rückgang der Bevölkerung trifft zuerst
strukturschwache Gebiete. Im Süden steht die Region Pirmasens
beispielhaft für das Problem. Man erprobt in der Pfalz längst
Strategien gegen Abwanderung - seit Jahrzehnten ist man
betroffen,
in: Stuttgarter Zeitung v. 21.11.
2012
BMFSFJ (2012):
Familienpolitik und Fertilität: demografische Entwicklungen und
politische Gestaltungsmöglichkeiten.
Monitor
Familienforschung, Ausgabe 27,
in:
bmfsfj.de, März
Die aktuelle
familienpolitische Selbstdarstellung des
Bundesfamilienministeriums bezieht sich bei der
Geburtenentwicklung in Deutschland nicht mehr auf die
bislang dominierende
nationalkonservative Position, sondern macht sich die
fortschrittliche Position des Max-Planck-Instituts für
demografische Forschung zu eigen, die von einer höheren
Geburtenrate in der jüngeren Generation ausgeht:
"Die Studien zeigen, dass
die um
den Tempo-Effekt korrigierte Geburtenrate bei etwa 1,6
Kindern pro Frau liegt (vgl. European Commission 2010: 32,
Goldstein/Kreyenfeld 2011). Das bedeutet, dass Frauen in
Deutschland aktuell im Durchschnitt etwa 1,6 Kinder bekommen
(gleichermaßen in West- wie Ostdeutsch-land). Es gibt sogar erste
Hinweise darauf, dass Frauen, die in den 1970er-Jahren
geboren wurden, im Durchschnitt wieder mehr Kinder bekommen
als die in den 1960er-Jahren geborenen Frauen."
EBBINGHAUS, Uwe (2012): 2030 - Odyssee in
eine gealterte Gesellschaft.
Mit der
Gestaltung von Europas Zukunft hat die Politik gerade alle Hände
voll zu tun. Dabei vergisst sie die alternde Gesellschaft.
Anhand seriöser Voraussagen wollen wir in einer erfundenen
Familiengeschichte ein Demenz- und Gesellschaftsszenario für das
Jahr 2030 entwerfen. Wie können wir altern?
in:
Frankfurter Allgemeine
Zeitung v. 10.03.
"Nach einer
Modellrechnung des Statistischen Bundesamtes ist (...)(Klaus
W.) einer von etwa zwei Millionen Alzheimer-Kranken - zu
Beginn des Jahrhunderts lag der Wert noch bei etwas mehr als
einer Million -, gehört zu den 6,3 Millionen Deutschen über
achtzig und den ungefähr drei Millionen Pflegebedürftigen
des Landes",
erläutert uns EBBINGHAUS
das Jahr 2030 und die Folgen des Geburtenrückgangs. Da haben
wir gewaltig Glück
gehabt, dass der Babyboom bereits Mitte der 1960er Jahre zu
Ende gewesen ist, denn dann würden wir 2030 womöglich Soylent Green
vorgesetzt bekommen.
Das Statistische Bundesamt
bietet lediglich eine
Modellrechnung für das Jahr 2030 (Stand: November 2010 )
an. Darin werden bei sinkenden Pflegequote 3 Millionen
Pflegebedürftige angegeben (S.30). Dies gilt jedoch nur
für eine Entwicklung, die der 12. koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung Variante "Untere Grenze mittlere
Bevölkerung" entspricht, die von 6,4 Millionen über 80
Jährigen ausgeht. Ausgangspunkt war das Jahr 2008 und es wird
von einer konstanten Geburtenrate von lediglich 1,4 bis 2030
ausgegangen. EBBINGHAUS behauptet dagegen - ohne dies zu
belegen,
"eine Anhebung der
Kinderzahl in Deutschland weit über die zu Beginn des
Jahrhunderts übliche Ziffer von 1,4 pro Paar hinaus ist die
Grundvoraussetzung für eine machbare Zukunft."
Für das Jahr 2011 wurde ein
Bevölkerungsstand von 81,374 Millionen prognostiziert.
Tatsächlich weist das Statistische Jahrbuch 81,752 Millionen
Einwohner aus. Der Zensus könnte jedoch diese Zahlen nach
unten korrigieren.
"An
Voraussagen der pflegewirtschaftlichen
Misere
2030 hat es nicht gemangelt. Im Jahr 2005 hatte Herwig
Birg im Feuilleton dieser Zeitung in einem »Grundkurs
Demographie« darauf hingewiesen, dass die absehbare
Schrumpfung unserer Gesellschaft deren Volkswirtschaft und
die durch Umlageverfahren finanzierten Sozialversicherungen
vor kaum lösbaren Probleme stellen werde. Wenig musste er
von seinen Voraussagen bis heute zurücknehmen",
behauptet EBBINGHAUS vage.
Überprüfen wir doch einmal BIRGs Thesen zur
Geburtenentwicklung in Deutschland aus dem Jahr 2005 an der
Realität:
"Die Geburtenrate fiel in
den neuen Ländern auf ein Minimum von 0,8 im Jahr 1994,
seitdem nähert sie sich von unten dem Niveau im Westen."
(Herwig
BIRG in der FAZ 26.02.2005)
"2008 stieg die
zusammengefasste Geburtenziffer in den neuen Ländern
erstmals seit der Deutschen Vereinigung auf ein höheres
Niveau als in den alten Ländern. 2010 brachten die
ostdeutschen Frauen mit 1,46 Kindern je Frau das dritte Mal
in Folge durchschnittlich mehr Kinder zur Welt als die
westdeutschen (1,39)."
(DESTATIS
"Geburten in Deutschland", 2012, S.15)
Die These von der
Angleichung der neuen an die alten Bundesländer, die Herwig
BIRG vertreten hat, ist von der Wirklichkeit längst überholt.
"Und wir sind heute
angekommen bei ungefähr 1,3 Kindern pro Frau und man kann
nicht hoffen oder man sollte nicht hoffen, dass damit auch
schon der Tiefpunkt erreicht ist. Denn (...) es ist eher
damit zu rechnen, dass die Kinderzahlen noch weiter
zurückgehen, als sie jetzt schon sind"
(Herwig
BIRG im DeutschlandRadio 16.03.2005)
"Der Rückgang im früheren
Bundesgebiet dauerte fast zwanzig Jahre und erreichte Mitte
der 1980er Jahre ein vorläufiges Tief mit 1,28 Kindern je
Frau. Danach schwankte die zusammengefasste Geburtenziffer
geringfügig zwischen 1,35 und 1,45 Kinder je Frau und lag im
Jahr 2010 bei 1,39."
(DESTATIS "Geburten in Deutschland", 2012, S.15)
Der
Abwärtstrend der Geburtenrate unter 1,3 ist bislang
ausgeblieben und es gibt
relevante Stimmen, die von einem Anstieg der Geburtenrate
in den jüngeren Frauenjahrgängen ausgehen.
"Die Geburtenrate beträgt
bei der deutschen Bevölkerung zwar wie in Spanien und
Italien etwa 1,2 Geburten pro Frau, bei der zugewanderten
rund 1,9 und im Durchschnitt, ähnlich wie in anderen
Ländern, 1,3 bis 1,4 Geburten, aber der Grund für das
niedrige Niveau ist ein besonderer: Der weltweit einmalig
hohe Anteil der Frauen und Männer an einem Jahrgang, die
zeitlebens kinderlos bleiben, lieg hierzulande bei etwa
einem Drittel."
(Herwig
BIRG in der FAZ 22.02.2005)
"Die zusammengefasste
Geburtenziffer der deutschen Frauen verharrt schon seit
zwanzig Jahren auf dem niedrigen Niveau von 1,3 Kindern je
Frau. Das Geburtenniveau der Ausländerinnen geht
kontinuierlich zurück.
Anfang der 1990er Jahre lag die zusammengefasste
Geburtenziffer ausländischer Frauen bei 2,0 Kinder je Frau.
Bis 2010 sank sie auf ca. 1,6. Dadurch näherten sich die
zusammengefassten Geburtenziffern deutscher und
ausländischer Frauen an."
(DESTATIS "Geburten in
Deutschland", 2012, S.22)
"Frauen der Jahrgänge
1939 bis 1963 vergrößerte sich dieser Abstand allmählich. In
den alten Ländern nahm die endgültige Kinderlosigkeit von 12
% auf 19 % zu, während sie in den neuen Ländern zunächst auf
dem sehr niedrigen Niveau von etwa 7 % verharrte
Bei den zwischen 1964 und 1968 geborenen Frauen nahm in den
neuen Ländern der Anteil der Kinderlosen erstmals auf 11 %
zu. Damit war er nur halb so hoch wie im früheren
Bundesgebiet: Hier war jede fünfte Frau in dieser
Jahrgangsgruppe (zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 40 und
44 Jahren) kinderlos (22 %)..
(DESTATIS "Geburten in Deutschland", 2012, S.28)
BIRG überschätzte zum einen
das Geburtenniveau der Ausländerinnen und zum anderen den
Anteil der Kinderlosen in den 1960er Jahren geborenen
westdeutschen Frauenjahrgängen. Statt zu einem Drittel sind
sie lediglich zu 22 % kinderlos geblieben. Damit liegt der
Anteil der Kinderlosen in Westdeutschland um ein Drittel
niedriger als von Herwig BIRG geschätzt. Nimmt man
Ostdeutschland hinzu, dann liegt der Kinderlosenanteil sogar
noch niedriger.
FAZIT: Herwig BIRG hat die
Geburtenentwicklung in Deutschland gravierend falsch
vorhergesagt. Das Bundesverfassungsgericht hat sein
Pflege-Urteil
2001 aber aufgrund der überhöhten Kinderlosenzahlen von
BIRG gefällt.
Wenn schon nach nur 7
Jahren die Geburtenentwicklung derart gravierend von der
Vorhersage abweicht. Wie sieht es dann erst im Jahr 2030 aus,
wenn BIRGs folgende These endlich einmal zutreffend wäre?
"Die Änderung der
Geburtenrate um einen bestimmten Prozentsatz wirkt sich um
ein vielfaches stärker auf das Bevölkerungswachstum aus als
eine gleich große Änderung der Lebenserwartung."
Schickt den Demagogen BIRG
also endlich aufs Altenteil und EBBINGHAUS sollte sich die
aktuellen Daten zur Kinderlosigkeit in Deutschland anschauen,
bevor er den Kinderlosenanteil "in Deutschland seit 1965" auf
"dreißig Prozent eines Jahrgangs" beziffert. Nach der Erhebung
von 2008 lag er bereits damals bei unter 20 % bei den 1964
-1968 Geborenen in Gesamtdeutschland und noch niedriger bei
den 1959-1963 Geborenen.
BREUER, Ingeborg (2012): Vom Kinderwunsch zum Kind.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Demografie: Die
Geburtenrate in Deutschland bleibt hinter dem Kinderwunsch
insbesondere deutscher Frauen zurück. Doch je nach
Berechnungsmethode der Geburtenrate ist nicht zwangsläufig ein
demografisches Problem zu erwarten,
in:
DeutschlandRadio v.
22.03.
PROMBERGER, Markus (2012):
Mythos der Vollbeschäftigung und Arbeitsmarkt der Zukunft,
in: Aus Politik
und Zeitgeschichte, Nr.14-15 v. 02.04.
ACKEREN, Margarete van/GOFFART, Daniel/RANDENBORGH,
Katrin van (2012): Deutschland wird mini.
Mit einer
großen Demografie-Strategie will Kanzlerin Merkel die drohenden
Folgen von Überalterung und Jugendmangel dämpfen. Doch CDU und
CSU streiten um Grundsätze wie Zuwanderung und Kinderbetreuung.
Verliert Merkel an Autorität?
in:
Focus Nr.17 v. 23.04.
Der Focus berichtet über die Kabinettsvorlage Jedes
Alter zählt, die am Mittwoch vom Bundeskabinett
beschlossen werden soll. Das Thema Demografie hatte in
Deutschland zwischen 2001 und 2006 Hochkonjunktur. Seit der
Einführung des Elterngeldes war mehr oder weniger Ruhe an der
Demografiefront. Das ändert sich nun wieder. Der letzte
Vorstoß zu einer "Demografie-Rücklage" wurde insbesondere von
der alten Mitte und hier besonders von der FAZ
publizistisch forciert (mehr hier und hier).
Jetzt folgt also eine
Demografie-Strategie der Bundesregierung. Innenminister
Hans-Peter FRIEDRICH erläutert dazu in der gestrigen Welt
am Sonntag:
"Am Mittwoch wird die
Demografiestrategie der Bundesregierung verabschiedet. Sie
beruht auf der Bestandsaufnahme des Demografieberichts vom
Oktober 2011 und benennt Chancen und Risiken der
demografischen Entwicklung. Gleichzeitig berücksichtigt sie
Beispiele des wegweisenden Umgangs mit dem demografischen
Wandel in vielen Kommunen Ostdeutschlands."
Es stellt sich die Frage,
wieso nun ein - auf völlig veralteten Daten beruhender
Demografiebericht - zur Grundlage genommen wird, statt die
Volkszählungsdaten abzuwarten, die voraussichtlich unser Bild
von Deutschland ziemlich durcheinanderwirbeln könnten.
Der
Demografiebericht, der im Oktober 2011 veröffentlicht wurde,
beruht auf einer Fortschreibung der Bevölkerungszahl des
Jahres 2009. Schon
im Oktober 2011 zeigten sich deutliche Abweichungen
zwischen Vorausberechnung und tatsächlicher Entwicklung. Die
im Januar 2012 veröffentlichten Daten zur
Bevölkerungsentwicklung gehen von einer Erhöhung statt von
einer Schrumpfung der Bevölkerungszahl für 2011 aus. Auch die
Daten zur Geburtenentwicklung werden zu pessimistisch
veranschlagt.
Nichts steht davon im
Focus, stattdessen bunte Bildchen, die angeblich den
Niedergang durch Vergreisung dokumentieren sollen.
Kaffeesatzleserei wird betrieben, wenn dem Jahr 2010 die
Situation im Jahr 2060 gegenüber gestellt wird.
Bereits vor 2 Jahren wollte der Focus ein
Schreckensszenario für das Jahr 2030 zeichnen, was grandios
misslang.
Es wird vorgerechnet, dass
es im Jahr 2030 ca. 6,3 Millionen Menschen weniger im
erwerbsfähigen Alter geben soll als 2010. Im erwerbsfähigen Alter
sind die 20-64 Jährigen, obwohl mit 20 kaum schon jemand
arbeitet und mit 64 kaum noch jemand. Dazwischen gibt es das
Heer der Arbeitslosen, Hartz-IV-Empfänger, in
Umschulungsmaßnahmen steckende Menschen usw. usf. Hier wird
also mit Zahlen jongliert, deren Aussagekraft mehr als dürftig
ist.
Im Demografiebericht wird für den
Zeitraum 1991 bis 2010 zwischen Gesamtbevölkerung,
Erwerbstätigen, Erwerbsfähigenquote (20-64Jährigen) und
Arbeitslosen differenziert. Dabei lässt sich erkennen, dass
zwischen Demografie und Arbeitsmarkt kein direkter
Zusammenhang besteht. So gab es z.B. im Jahr 1996 zwar ca. 1
Million mehr Erwerbsfähige im Alter zwischen 20 und 65 Jahren
als 2009, aber erwerbstätig waren 2009 ca. 2,7 Millionen mehr
Menschen als 1996. Die Arbeitslosigkeit war zudem 1996 um ca.
eine halbe Million Menschen höher. Vor diesem Hintergrund
stellt sich viel eher die Frage, ob mit dem angeblichen
Schreckgespenst Demografie nicht von der zunehmenden
Ungleichheit innerhalb der Generationen abgelenkt werden soll.
|
Schaubild: Bevölkerung (in Tausend) und Arbeitsmarkt |
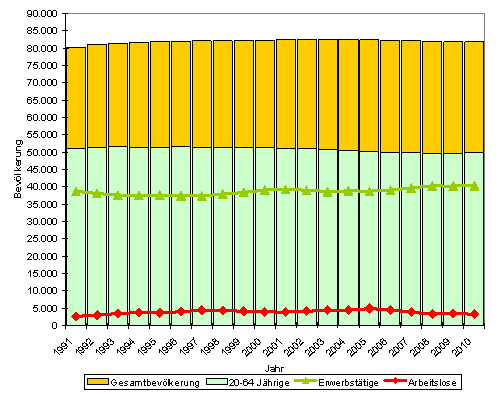 |
|
Datenquelle: Demografiebericht, 2011, S.101 |
Wie sehen die
Gegenstrategien aus? Da ist neben der Erhöhung der
Frauenquote, Erhöhung der Lebensarbeitszeit und der
Zuwanderung Hochqualifizierter, der
Kampf gegen die
späte Elternschaft zu nennen, der hier schon seit einiger Zeit beobachtet
wurde und zu dem es im Focus heißt:
"Erfrischend deutlich wird
die um Nachwuchs besorgte Koalition nur an der Stelle, an der
sie die Studentinnen zum Kinderkriegen auffordert. (...). Auf
Deutsch: Beeilt euch Mädels und Jungs, und wartet nicht mehr
so lange mit dem Nachwuchs! Ausbildung und Studium sollen
Kinderfreuden nicht mehr bremsen."
Schwarzmalern wie
Elisabeth NIEJAHR ist die Sicht der Kabinettsvorlage zu
schönfärberisch.
TICHOMIROWA, Katja (2012): Keine Angst vor den Alten.
Gespräch:
Dass viele Alte zu vielen Problemen führen, ist für die
Soziologin Silke van Dyk ein Fehlschluss. Die Alterung der
Gesellschaft gefährdet ihrer Meinung nach nicht einmal das
Rentensystem,
in:
Berliner Zeitung v.
02.05.
"Die Frage der
Altersstruktur der Gesellschaft ist nur ein Aspekt unter
vielen, die darüber entscheiden, ob ein Umlagesystem wie in
der Bundesrepublik funktioniert oder nicht. Ganz entscheidend
für Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen
Rentenversicherung sind stagnierende und sinkende Reallöhne,
denn das ist die Einnahmebasis. Doch davon hören wir in der
dramatisierenden Diskussion über das Rentensystem wenig. Das
ist eines der vielen Beispiele wie eine soziale Frage
plötzlich als
Generationen- beziehungsweise Demografieproblem verkleidet
wird", kritisiert
Silke van DYK die
Demographisierung des Gesellschaftlichen.
MÖLLER, Joachim (2012): Es fehlen Fachkräfte, weil die
Gesellschaft altert - stimmt's?
Mythen der
Arbeit: Der demografische Wandel krempelt Arbeitsmarkt und
Gesellschaft kräftig um. Doch die Engpässe, die Unternehmen bei
bestimmten Fachkräften bereits heute beklagen, lassen sich noch
nicht auf den demografischen Wandel zurückführen, erklärt
Arbeitsforscher,
in:
Spiegel Online v.
11.06.
HENRICH, Anke/KIANI-KRESS,
Rüdiger/KROKER, Michael/KUTTER, Susanne/SEIWERT,
Martin/SCHUMACHER, Harald (2012): Die Methusalem-Dividende.
Demografie: Die Deutschen altern schneller als manch andere
Gesellschaften. Unter dem Deckmantel des Komforts für jedermann
entwickeln Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für
Senioren, die Exportschlager werden könnten. Aber viele Branchen
verschlafen ihre Chance,
in:
Wirtschaftswoche Nr.24
v. 11.06.
"Weil Deutschland
besonders schnell altert, sind die Unternehmen hier Teil
eines Zukunftslabors, in dem sie schon heute Angebote von
morgen an der eigenen Bevölkerung testen können. Was sich im
größten Markt Europas bewährt, wird früher oder später
überall gefragt sein",
meinen die Autoren. Von
Ausgaben für Gesundheit, Reisen und Altersvorsorge erhofft man
sich zukünftig Wirtschaftswachstum. Als Beispiele für Produkte
und Dienstleistungen werden genannt: Assistenzsysteme fürs
Auto, Netzwerke für Ältere wie seniorentreff.de,
Qualifizierungsberatung für Ältere, seniorenadäquate
Wohnformen, Wohnanlagen für Demenzkranke (bei denen eine
Steigerung "bis 2030 auf drei Millionen" erwartet wird),
Haushaltshilfen ("Caregivers") und Pflegedienstleistungen,
innovative Notrufdienste und neue Finanzdienstleistungen.
Druck auf eine Reform des
Krankenversicherungssystems geht von der Pharmabranche aus,
die stärker von altengerechten Medikamenten profitieren
möchte:
"Pharmaunternehmen (...)
müssen sich wegen der Sparzwänge der Krankenkassen auf harte
juristische Auseinandersetzungen einstellen, wenn sie von
den typischen Malaisen des Alterns profitieren wollen."
Einsparpotenziale im
Kranken- und Pflegeversicherungswesen sehen dagegen
Wissenschaftler wie Andreas KRUSE:
"Seit Jahren weisen
Altersforscher nach, dass geistiges Training schon in
jüngeren Jahren nicht nur Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
fördert. Auch Demenzerkrankungen lassen sich so auf viele
Jahre hinauszögern."
HECKEL, Margaret (2012): Alle können profitieren.
Deutschland altert,
aber es gibt unzählige konstruktive Strategien, um damit
umzugehen,
in: Das Parlament v. 06.08.
WORATSCHKA, Rainer (2012): Politik braucht Prognosen.
Statistik
I: Eine exakte Vorhersage der Zahlen und Fakten zu
Bevölkerungsentwicklung, Lebenserwartung und
Versicherungsbeiträgen in 30 Jahren ist heute unmöglich. Und
trotzdem gibt es Berechnungen bis auf zwei Kommastellen,
in: Das Parlament v. 06.08.
Rainer WORATSCHKA
erläutert, warum Prognosen über 40 und mehr Jahre hinweg
unseriös sind. Insbesondere den Prognosen der
Versicherungsbranche und ihren Helfershelfern sowie den
Profiteuren eines Sozialabbaus sollte nicht getraut werden.
Bereits die
prognostizierten Zahlen der Pflegebedürftigen für das Jahr
2030 differieren beträchtlich.
Gemäß der Soziologin Ewa SOJKA gelangt man aufgrund zweier
Szenarien hinsichtlich der Entwicklung der Pflegebedürftigkeit
zu Werten zwischen 2,95 und 3,36 Millionen Pflegebedürftigen.
Bernd REUSCHENBACH von der Katholischen
Stiftungsfachhochschule in München (SZ
vom 24.01.2012) verweist ebenfalls auf zwei Szenarien, bei
denen im einen Fall ein Anstieg von 45.000 Pflegebedürftigen
pro Jahr zwischen 2020 und 2030 erwartet wird, während sich im
anderen Fall der Anstieg nur auf 27.000 Pflegebedürftige pro
Jahr belaufen würde.
Bereits die
Bevölkerungsentwicklung an sich ist nicht so genau
vorherzusagen, wie
die
letzten Bevölkerungsvorausberechnungen zeigen.
Komplizierter wird es dann, wenn diese Entwicklungen auch noch
mit anderen Entwicklungen (Rentner, Erwerbstätige,
Pflegebedürftige usw.) hochgerechnet werden. Dann können sich
die Schwankungsbreiten der einzelnen Entwicklungen zu
gravierenden Fehleinschätzungen aufsummieren. Etliche der
Bevölkerungsvorausberechnungen der vergangenen Jahrzehnte
waren bereits nach nicht einmal 10 Jahren völlig überholt.
|
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG-Thema:
Die Kunst zu altern - Warum es nicht schlimm sein muss, immer
länger zu leben |
WIEGAND, Ralf
(2012): Generation Herbst.
In den kommenden Jahren wird sich
Deutschland grundlegend wandeln: Mehr und mehr Bürger werden
betagt sein. Doch was heißt das dann? Vermutlich, dass die
Menschen immer noch arbeiten werden, vielleicht, dass sie sich
gegenseitig pflegen werden. Die Gewissheiten von heute werden
jedenfalls nicht mehr gelten,
in: Süddeutsche Zeitung v. 20.10.
BOSBACH, Gerd (2012): Produktivität schlägt Demografie.
Was in der
Rentendebatte bewusst verschleiert wird,
in: DeutschlandRadio v. 30.10.
JELLEN, Reinhard (2012): Großfamilie 2.0.
Der
Trendforscher Eike Wenzel über die Zukunft,
in: Telepolis v. 31.12.
2013
HENZLER,
Claudia (2013): Bis zum letzten Mann.
SZ-Thema Die Provinz verwaist:
Von Nordfriesland bis Heidesheim: Gemeinden versuchen alles,
damit ihre Einwohner bleiben. Sie sanieren ihre Städte, fördern
die Industrie: Es ist ein Wettstreit, den nicht alle gewinnen
werden,
in: Süddeutsche
Zeitung v. 12.01.
MPIDR
(2013): Endgültige Geburtenraten werden steigen.
Neue Vorausberechnung: Die
Zeit sinkender Kinderzahlen pro Frau in entwickelten Ländern
geht zu Ende. Auch in Deutschland wird die Rate wieder wachsen,
in:
Pressemitteilung des
Max-Planck-Institut für demografische Forschung v. 21.03.
WURZBACHER, Ralf (2013): "Und solche Leute beraten die
Politiker…".
Bertelsmann-Stiftung frisierte
Statistiken zur Bevölkerungsentwicklung – und wurde dabei
erwischt. Gespräch mit Gerd Bosbach,
in:
junge Welt v. 22.03.
WIERTH, Alke (2013): Von Kindern kalt erwischt.
Schulplatznot: In Berlin
steigt die Kinderzahl schneller als erwartet. In manchen
Bezirken platzen die Grundschulen schon aus allen Nähten.
Schnelle Hilfe ist aber nicht in Sicht,
in:
TAZ Berlin v. 28.03.
"Die
Senatsbildungsverwaltung musste ihre Prognose über die
Schülerzahlentwicklung von 2012 auf 2013 allein für
Grundschüler um gut 19.000 nach oben korrigieren. Insgesamt
wird die Schülerzahl in Berlin nach der neuen Prognose bis
2020 um gut 12 Prozent steigen: von 289.152 auf 325.630.
Noch vor einem Jahr hatte die Verwaltung einen Anstieg in
diesem Zeitraum auf nur 300.000 erwartet. (...). Der
unerwartete Anstieg der Schülerzahlen sei der
»außerordentlich positiven Bevölkerungsentwicklung seit der
Erstellung der letzten Prognose im Jahr 2008«
zu verdanken, heißt es aus der Senatsbildungsverwaltung.",
berichtet Alke WIERTH.
Während
neoliberale Kaffeesatzleser wie Martin WERDING von gleich bleibenden
Geburtenzahlen bis 2060 ausgehen, sieht die Realität schon
heute ganz anders aus.
Die
Bevölkerungsvorausberechnungen der letzten Jahrzehnte
waren das Papier nicht wert, auf denen sie geschrieben
standen.
Inzwischen kritisiert auch Joshua GOLDSTEIN, Direktor des
Max-Planck-Instituts für demografische Forschung, die
Prognosepraxis in Deutschland.
BREUER, Ingeborg (2013): Neue Ergebnisse der Demografie.
Deutschlands Bevölkerung nimmt
wieder zu: Hunderttausende strömen als Arbeitssuchende in die
Bundesrepublik. Zudem prognostizieren Wissenschaftler eine
steigende Geburtenrate. Während Optimisten hoffen, den
demografischen Wandel stoppen zu können, bleiben Statistiker
realistisch,
in:
DeutschlandRadio v. 18.04.
KALARICKAL, Jasmin (2013): "Die Kohortenfertilität nimmt zu".
Demografie:
Eine neue Prognose sagt, dass Frauen in Deutschland wieder mehr
Kinder kriegen. Das sei ein echter Wendepunkt, meint die
Demografin Michaela Kreyenfeld,
in: TAZ
v. 29.04.
NOWAKOWSKI, Gerd (2013): Die Zukunft beginnt jetzt.
In der Metropolenregion Berlin
könnten 2030 fünf Millionen Menschen in Wohlstand leben – nicht
zuletzt mit dem Potenzial von Zuzüglern aus aller Welt und
Großkonzernen, die jetzt als Start-ups beginnen. Der Auftakt
einer Serie über die Stadt von morgen,
in:
Tagesspiegel v. 25.05.
Gerd NOWAKOWSKI betreibt
Stadtmarketing, indem er das Wachstum des "gefühlten Berlin"
bis 2030 beschreibt:
"Die Bevölkerung hat in
den vergangenen drei Jahren um 100 000 Menschen zugenommen;
bis 2030 könnten es noch 250 000 Menschen mehr werden.
Hinter der Stadtgrenze, wo Falkensee schon die am
schnellsten wachsende Gemeinde Deutschlands ist, werden sich
zusätzlich Menschen konzentrieren – Brandenburger, die näher
an den Jobs der Hauptstadtregion sein wollen oder auch aus
anderen Bundesländern neu Hinzugezogene. Das Siedlungsgebiet
Berlins wird dann weit über die jetzige Stadtgrenze
hinausgreifen. Dabei ist es völlig egal, ob die Politik bis
2030 noch eine Länderfusion zustande bekommt: Im Herzen
werden sich die dann fünf Millionen Menschen im Ballungsraum
als Berliner fühlen."
DESTATIS (2013): Zensus 2011: 80,2 Millionen Einwohner lebten am
9. Mai 2011 in Deutschland.
Rund 1,5
Millionen Einwohner weniger als bislang angenommen,
in: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt Wiesbaden
v. 31.05.
Das Ergebnis des Zensus
2011 ist der Tendenz nach wenig überraschend. Entscheidend
sind aber die Details - insbesondere das was heute auf der
Bundespressekonferenz verschwiegen wurde: Die Anzahl der
Kinder unter 18 Jahren ist unterdurchschnittlich
zurückgegangen, während die Anzahl der gebärfähigen Frauen
überdurchschnittlich zurückgegangen sein könnte (Darauf deutet
zumindest der überdurchschnittliche Rückgang der 18-49
Jährigen hin (siehe
Tabellenband zur Bundespressekonferenz, Tabelle 3.1). Dies
müsste dann zwangsläufig zur Korrektur der Geburtenrate (TFR)
nach oben führen.
Da das Statistische
Bundesamt die Tabellen für den Altersgruppenvergleich
Zensus/Mikrozensus 2011 nicht nach Geschlechtern getrennt
aufführt, lassen sich die genauen Daten nur durch eigene
Berechnungen ermitteln. Warum liefert das Statistische
Bundesamt diese Daten nicht, obwohl sie doch familienpolitisch
von Interesse sind? Passen die Daten nicht zur gegenwärtigen
familienpolitischen Strategie der Bundesregierung?
EISENACH, Tanja (2013): Niedrigere Einwohnerzahl, höhere
Geburtenrate in Deutschland.
Der
Zensus, seine Ergebnisse und die Folgen,
in: Pressemitteilung der Universität Bamberg v.
31.05.
Die SZ klärte vor
einiger Zeit ihr Online-Publikum darüber auf, dass die
gefühlte Geburtenrate viel höher sei als die tatsächliche. Der
Zensus 2011 stellt nun richtig: die gefühlte Geburtenrate
liegt näher an der tatsächlichen Geburtenrate als die von
unseren Bevölkerungswissenschaftlern bislang verbreitete
Geburtenrate. Das sieht nun auch die
Bevölkerungswissenschaftlerin Henriette ENGELHARDT-WÖLFLER von
der Universität Bamberg so:
"Beachtenswerte
Konsequenzen hält der Zensus auch für die Messung des
Niveaus der Fertilität bereit, die neben Mortalität und
Migration das Hauptinteressensgebiet der
Bevölkerungswissenschaft darstellt: Betrachtet man die dafür
relevanteste Altersgruppe, also Frauen, die zwischen 1961
und 1981 geboren wurden, dann hätte sich ihre Gesamtzahl
laut Fortschreibung auf knapp 23,2 Millionen Personen
belaufen müssen. Tatsächlich erbrachte der Zensus ein
Ergebnis von ca. 22,6 Millionen und damit eine Differenz von
knapp 600.000 Frauen in dieser Altersgruppe. Dazu Henriette
Engelhardt-Wölfler: »Wenn die Geburtenzahlen stimmen, und
davon können wir ausgehen, weil diese in den Krankenhäusern
und Geburtshäusern registriert werden, dann würde dieses
Ergebnis bedeuten, dass die Geburtenrate höher liegt als
bislang angenommen.«"
Dass diese Konsequenzen - wie auf single-generation.de
bereits bemängelt - in der Bundespressekonferenz verschwiegen
wurden, sollte zu denken geben.
Die Ergebnisse des Zensus
2011 haben zudem gravierende Auswirkungen auf den Bedarf an
Kinderbetreuung:
"Die Höhe der
Geburtenrate bzw. die der Geburten hat wiederum Auswirkungen
auf die Bedarfs- und Infrastrukturkalkulationen bei
Kindergärten und -tagesstätten, Krippen und Schulen, wie
Engelhardt-Wölfler zu berichten weiß:
»Am
Beispiel Bambergs lässt sich das schön zeigen. Der Zensus
zählt 9.900 Personen, die zwischen 1994 und 2011 geboren
sind, was laut Fortschreibung eine Differenz von plus 300
ergibt. Damit erhöht sich natürlich der Bedarf an
Kindergärten, -tagesstätten, Krippen und Schulen.«"
Es ist seit langem bekannt,
dass in Deutschland die Geburtenrate unterschätzt wird. Das
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und das Statistische
Bundesamt verweigern sich (noch) beharrlich der Anerkennung
dieser Realität, wie das
gerade erschienene Heft 3 von Bevölkerungsforschung Aktuell
belegt. Dort wird noch einmal der Standpunkt aus einer
Sendung
des DeutschlandRadio bekräftigt.
Man darf wohl vor den
Bundestagswahlen nicht mit einer Revidierung dieser Sichtweise
rechnen. Einzig die jetzt wohl unvermeidliche Debatte über die
Fehlprognosen hinsichtlich des unterschätzten Bedarfs an
Kinderbetreuungseinrichtungen könnte hier den notwendigen
Druck erzeugen.
CICERO-Titelgeschichte:
Hurra, wir wachsen!
Das Demografie-Wunder. Deutschland auf dem Weg zum
100-Millionen-Volk |
RINKE, Andreas & Christian SCHWÄGERL (2013): Die
100-Millionen-Chance.
Deutschland schrumpft, sagt die
Kanzlerin. Alle Politik dreht sich nur darum, mit dem Schwund zu leben.
Aber die Zukunft ist längst da. Deutschland wächst: im vergangenen
Jahr um 200 000 Menschen. Und das ist erst der Anfang,
in:
Cicero, Juni
Dumm gelaufen! Einen
ungünstigeren Zeitpunkt hätte man sich für diese
Titelgeschichte nicht aussuchen können. Kurz vor der
Veröffentlichung der Zensusdaten zur
Bevölkerungsfortschreibung, kommen die Autoren nun mit Zahlen,
die längst überholt sind. Wir wachsen. Ja! Aber auf
niedrigerem Niveau und das ist gut so!
"233
000 Hallenser gibt es heute, über 2000 mehr als noch vor
vier Jahren,"
verkünden RINKE & SCHWÄGERL
überschwänglich über das Symbol der schrumpfenden Stadt, das
nach Willen der Autoren zum Symbol der wachsenden Stadt werden
soll. Der Zensus 2011 ergibt dagegen im Vergleich zum
Mikrozensus 2011 eine um 3211 niedrigere Einwohnerzahl für
Halle. Halle mag gewachsen sein, aber auf niedrigerem Niveau.
Und das gilt für ganz Deutschland (Ausnahmen wie Bielefeld
bestätigen nur die Regel).
Berlin z.B. das Gerd
NOWAKOWSKI gerade im Tagesspiegel
zum zukünftigen 5 Millionen-Ballungsraum stilisiert hat, die
Stadt Berlin ist von heute auf morgen um 175.870 Einwohner
bzw. 5 % geschrumpft.
Und es kommt noch
schlimmer:
"Demografische Prognosen
sind (...) kein Naturereignis, kein unabwendbares Schicksal.
Das gilt selbst für die Geburtenrate, die Hauptursache
dafür, dass die deutsche Bevölkerung geschrumpft ist. Von
rund einer Million Geburten im Jahr 1970 ist die Zahl auf
663 000 im Jahr 2011 gesunken. Die Gruppe der potenziellen
Mütter, also von Frauen zwischen 15 und 49 Jahren, wurde als
Folge davon allein seit 2004 um rund eine Million kleiner.
Weniger Mütter, weniger Kinder, das liegt auf der Hand, dazu
kommt die große Anzahl kinderloser Frauen, die die
durchschnittliche Kinderzahl drückt",
erzählen uns RINKE &
SCHWÄGERL. Während sie bei der Lebenserwartung Auswirkungen
des Zensus 2011 aufzeigen, bleiben die Auswirkungen des Zensus
2011 auf die Geburtenrate unerwähnt.
Die
Bevölkerungswissenschaftlerin
Henriette ENGELHARDT-WÖLFLER von der Universität Bamberg
geht von rund 600.000 weniger potenziellen Müttern
allein bei den 20 - 40
jährigen Frauen aus. Dies bedeutet, dass die Geburtenrate
bereits 2011 über 1,4 (TFR) lag, denn die Zahl der Geburten
bleibt unverändert. Wenn weniger gebärfähige Frauen die
gleiche Zahl von Kindern geboren haben, dann war zwangsläufig
in den vergangenen Jahren die Geburtenrate höher.
Wie viel, das erfahren wir
hoffentlich bald - vorausgesetzt die Öffentlichkeit macht
Druck. Denn unsere Presse schläft selig, was den
demografischen Wandel betrifft! Oder wie kann es sein, dass
dieser wichtige Aspekt des Zensus 2011 sich nicht in
Windeseile verbreitet?
RINKE,
Andreas & Christian SCHWÄGERL (2013): Und Deutschland wächst
doch.
Volkszählung und
Schrumpfungslogik: Die Ergebnisse des Zensus sagen wenig über
die künftige Entwicklung der Bevölkerung aus, aber viel über die
demografische Verblendung in Deutschland,
in:
Cicero Online v.
01.06.
Dumm gelaufen! Einen Tag
nach der Veröffentlichung der Zensus 2011-Ergebnisse müssen
nun RINKE & SCHWÄGERL Missverständnisse ausräumen, die gar
nicht entstanden wären, hätten die Autoren mit
ihrem Cicero-Artikel die
Veröffentlichung der Zensusergebnisse 2011 abgewartet.
Und warum soll jetzt
eigentlich Zensus statt Mikrozensus 2011 richtig sein, wie die
Autoren am Ende des Artikels schreiben? Offenbar sind die
Autoren ein wenig verwirrt. Ihre Daten, die sie im Cicero
veröffentlichten, stammten vom Mikrozensus 2011. Warum soll
das nun falsch sein? Nur weil der Zensus 2011 im Gegensatz zum
Mikrozensus 2011 niedrigere Zahlen ausweist?
Interessanter als diese
Reaktion, ist das
Interview von Marie AMRHEIN mit Norbert F. SCHNEIDER, dem
Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung
am Tag der Veröffentlichung der Zensus 2011-Ergebnisse.
Erstmals räumt ein Repräsentant des Instituts ein, dass die
Geburtenrate bereits jetzt höher liegen könnte als 1,4.
Bislang weigerte man sich dort hartnäckig, dies anzuerkennen:
"Marie Amrhein: James
Vaupel, Direktor am Max-Planck-Institut für demografische
Forschung in Rostock, sagt im aktuellen Cicero, er sähe
Anzeichen dafür, dass die offiziellen Prognosen zur
Bevölkerungsentwicklung „daneben liegen“.
Norbert F. Schneider: Bei der Geburtenrate kann das
stimmen. Die amtlichen Prognosen gehen auch von der Variante
aus, dass die Geburtenrate in zehn Jahren von 1,4 auf 1,6
ansteigt. Dabei liegt sie wahrscheinlich heute schon bei 1,6
Kindern pro Frau. Grund sind unterschiedliche Modelle zur
Berechnung von Tempoeffekten.
Können Sie die erklären?
Die Vorausberechnungen der amtlichen Statistik rechnen
mit der Total Fertility Rate (TFR), der durchschnittlichen
Kinderzahl pro Frau je Kalenderjahr. Man geht davon aus,
dass sich das Geburtenverhalten der in diesem Jahr
15-jährigen Mädchen in den nächsten dreißig Jahren so
entwickelt, wie bei den dreißig Frauenjahrgängen vor ihnen.
So ergeben sich die 1,4 Kinder. Wenn die Menschen in den
letzten Jahren ihre Kinder aber immer später bekommen haben,
dann führt das zu einer systematischen Unterschätzung dieser
Zahl."
Bislang argumentierte man,
dass es zwei unterschiedliche Berechnungsarten gäbe, die aber
nichts miteinander zu tun hätten, ergo die Geburtenrate TFR
die einzig Richtige sei. Auf single-generation.de wurde
das immer wieder kritisiert,
zuletzt ausführlich im Winterthema vom Oktober 2012.
Mit dem Zensus 2011, durch
den nun auch die Geburtenrate TFR nach oben korrigiert werden
muss, lässt sich die bislang verfolgte Linie nicht mehr
aufrechterhalten.
Wie lange dauert es also
noch, bis die aktualisierte Geburtenrate verfügbar ist? Warum
schläft unsere Presse in dieser Frage selig?
SCHWENTKER, Björn
(2013): Irren ist amtlich.
In Deutschland leben 1,5
Millionen Menschen weniger als gedacht. Der Zensus 2011
offenbart, wie ungenau die Republik ihre Einwohnerzahlen kennt.
Nun steht das gesamte Erhebungsverfahren zur Debatte,
in:
Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung v. 02.06.
DORBRITZ,
Jürgen & Robert NADERI (2013): Trendwende beim Kinderwunsch?
in: Bevölkerungsforschung
aktuell, Nr.4, August
KOCH, Hannes
(2013): Demograf Dracula.
Arbeit: Ökonomen schwärmen
schon vom Ende der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Doch so wird
es wohl nicht kommen,
in: Freitag
Nr.32 v. 08.08.
Die FAZ hat bereits im
Frühjahr das Paradies der Vollbeschäftigung
herbeigeschrieben.
Unter Berufung auf den DIW-Ökonomen Karl BRENKE
schreibt dagegen Hannes KOCH:
"In zehn Jahren könnte
das Angebot an Arbeitskräften größer und die Zahl der
offenen Stellen kleiner sein, als die Anhänger der These von
der Vollbeschäftigung glauben."
SCHWENTKER, Björn (2013): Stichprobenfehler bei Volkszählung:
Juristen halten Zensus für gesetzwidrig.
Verstößt der Zensus 2011 gegen das Gesetz? Datenrecherchen von
SPIEGEL ONLINE zeigen: Die Stichprobe, aus der die neuen
Einwohnerzahlen hochgerechnet wurden, war wesentlich ungenauer
als erlaubt. Nun droht eine Klagewelle,
in:
Spiegel Online v.
19.08.
DESTATIS (2013): 80,5 Millionen Einwohner am Jahresende 2012
–Bevölkerungszunahme durch hohe Zuwanderung,
in: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt Wiesbaden
v. 27.08.
"Die Zahl der Gestorbenen
übersteigt die Zahl der Geborenen immer mehr. Das dadurch
rasant wachsende Geburtendefizit kann nicht von der
Nettozuwanderung kompensiert werden. Die Bevölkerungszahl in
Deutschland, die bereits seit 2003 rückläufig ist, wird
demzufolge weiter abnehmen. Bei der Fortsetzung der
aktuellen demografischen Entwicklung wird die Einwohnerzahl
von circa 82 Millionen am Ende des Jahres 2008 auf etwa 65
(Untergrenze der
»mittleren«
Bevölkerung) beziehungsweise 70 Millionen (Obergrenze der
»mittleren«
Bevölkerung) im Jahr 2060 abnehmen",
hieß es in der
Einführung zur 12. koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung vom November 2009. Im Juli 2012
hieß es dann in einer Pressemeldung:
"Zum Jahresende 2011
stieg nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen
Bundesamtes (Destatis) die Einwohnerzahl Deutschlands im
Vergleich zum Vorjahr um 92 000 Personen (+ 0,1 %) auf mehr
als 81,8 Millionen. Dies ist die erste, wenn auch nur
leichte Zunahme der Bevölkerung in Deutschland seit 2002.
Hauptursache war die deutlich gestiegene Zuwanderung in
2011"
2012 ist die Bevölkerung
erneut gestiegen - eine Entwicklung, die nicht vorgesehen ist.
Und es kommt noch
schlimmer! Da der Zensus 2011 eine um 1,5 Millionen geringere
Zahl von Einwohnern sowie Verschiebungen im Bevölkerungsaufbau
erbrachte, muss sowohl die Geburtenrate
als auch die
rohe Geburtenziffer nach oben korrigiert werden. Die
aktuelle 12. Bevölkerungsvorausberechnung muss also so schnell
wie möglich ersetzt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch die
Umstellung der Berechnungen auf die Basis des Zensus 2011.
Dafür lässt sich das Statistische Bundesamt jedoch Zeit.
Könnte man sonst keinen populistischen Familienwahlkampf
führen?
TSCHECHNÉ,
Martin (2013):
Ein Land ohne Kinder?
Zoë ist drei Jahre alt. Wenn
sie fünfzig ist, wird sie immer noch zu den Jüngeren gehören.
Und ihre Chancen stehen gut, einmal hundert zu werden. Unsere
Gesellschaft ändert sich, sie wird älter. Wissenschaftler bieten
schon heute Einblicke in diese Zukunft. Und sie sagen, wo wir
gegensteuern müssen,
in:
Psychologie Heute,
September
Bereits der Untertitel
verrät es: Die Zeitschrift ist eine Publikation für
Besserverdienende, denn die Mehrzahl der Bevölkerung wird eher
nicht die versprochenen 100 Jahre erreichen. Die soziale
Ungleichheit wächst in Deutschland und die Altersarmut ist
politisch gewollt auf Zunahme programmiert. Beides steht einer
weiteren Höherentwicklung der Lebenserwartung entgegen.
Wenn der jetzige Trend zur
Entwicklung einer kleinen oberen Mittelschicht, die zusammen
mit der Oberschicht die Gewinner der gegenwärtigen
Gesellschaftsentwicklung sind, und einer größer werdenden
mittleren und unteren Mittelschicht, die zusammen mit der
Unterschicht zu den Verlierern zählen wird, dann sieht unsere
Bevölkerung bis zum Jahr 2060 ganz anders aus, als es
Demagogen wie Martin TSCHECHNÉ uns heute erzählen. Der
"Vergnügungsdampfer in der Karibik", auf den die Rentner
"verbannt" sein sollen - diese Vision ist dann so veraltet wie
futuristische Visionen der 1960er Jahre für das Jahr 2000. Und
das waren nur 40 Jahre und keine 50 Jahre wie bei unseren
Kaffeesatzlesern.
Was
passiert, wenn die soziale Schließung sich weiter verstärkt?
Wenn der Kampf um Bildung härter wird, wie das der Soziologe
Heinz BUDE in seinem Artikel Das prekäre Gut der Bildung
(Merkur, August 2013) beschreibt?
"Es ist ein soziales
Gesetz, dass Familien erhebliche Anstrengungen unternehmen,
um den erreichten sozialen Status in der Generationenfolge
zu sichern. Hat man mehr als drei Kinder, kann man lockerer
und fehlerfreundlicher an diese Aufgabe herangehen, als wenn
lediglich ein oder zwei Kinder in der Familie existieren.
(...).
In der Mitte freilich reduziert sich die Kinderzahl und
steigt das Investitionsbewusstsein in Bezug auf das einzelne
Kind."
Gibt es eine homogene Mitte
überhaupt noch oder haben sich nicht schon unterschiedliche
Strategien herausgebildet? Cornelia KOPPETSCH beschreibt in
ihrem Buch Die Wiederkehr der Konformität drei
Strategien im Kampf der Mittelschicht gegen den befürchteten
Abstieg. Demnach beschreibt BUDE lediglich die Strategie der
oberen Mittelschicht, die sich ums Erbe dreht.
Die Bevölkerungsentwicklung
hängt keineswegs von demografischen Sachzwängen ab, sondern in
erster Linie vom Ausgang der politischen Kämpfe in der Mitte.
Die zukünftige Bevölkerungsentwicklung ist nicht
vorprogrammiert wie uns unsere Demagogen in Sachen
demografischer Wandel erzählen, sondern sie ist eine
politische Richtungsentscheidung.
|
WELT-Themenausgabe:
Keine Angst vor der Zukunft |
GOTTHOLD, Kathrin & Karsten SEIBEL (2013): Der Kampf um einen
schönen Ruhestand.
Den Lebensstandard zu halten, wird
von Jahr zu Jahr schwieriger. Auch Wohlhabende stehen vor Problemen,
in: Welt v. 06.09.
Die Finanzdienstleister
sind auf der Suche nach neuen Zielgruppen für die
Altersvorsorgelücke. Bernd RAFFELSHÜSCHEN, der gerne als
"Altersvorsorge-Experte" tituliert wird - aber lediglich
Lobbyist der Finanzdienstleister ist und an vorderster Front
mithalf die gesetzliche Rente zu diskreditieren - darf Werbung
betreiben. Eine Zielgruppe sind kinderlose Immobilienbesitzer:
"»Vor allem kinderlose
Immobilienbesitzer (...)«
(...)(sollen) in zwanzig Jahren ein Drittel aller Alten
ausmachen."
Eine Prognose, die kaum
wahrscheinlich ist, höchstens man zählt Eltern, deren Kinder
aus dem Hause oder bereits gestorben sind, zu den Kinderlosen.
Ganz unverhohlen wird
Werbung betrieben, wenn Studien von Versicherungen einfach
wiedergekäut werden wie z.B. im Bereich der Pflege, wo analog
zur Altersvorsorgelücke die "Pflege-Lücke" propagiert wird.
Mit welchen statistischen
Tricks die Zukunft von Lobbyisten der Finanzdienstleister
düster gezeichnet werden, kann man bei Gerd BOSBACH & Jens
Jürgen KORFF im Beitrag
Altersarmut in einem reichen Land
nachlesen.
KUHN, Eva & Reiner
KLINGHOLZ (2013): Vielfalt statt Gleichwertigkeit. Was
Bevölkerungsrückgang für die Versorgung ländlicher Regionen
bedeutet, Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung in
Kooperation mit dem Institute for Advanced Sustainability
Studies (IASS) Potsdam
Broschüre des privaten
Propagandainstitut,
das mediale Erregung produziert, um die Demographisierung
gesellschaftlicher Probleme gesellschaftsfähig zu machen.
HAUN, Daniel (2013): Werden wir wirklich zu alt?
Dossier: Vier Irrtümer über
den Demografiewandel und eine Bitte an den Bundestag,
in:
ZEITWISSEN,
Oktober/November
RIEVELER, Hans D. (2013): Unseren täglichen Fachkräftemangel gib
uns heute!
Wirtschaftslobbyisten müssen
sich nicht sorgen, dass die Vierte Macht im Staat ihr Stoßgebet
erhört. Deutschlands Medien streuen immer wieder kritiklos die
Ergebnisse sogenannter Studien von INSM, IW, Bertelsmann
Stiftung & Co. unters Volk,
in:
Telepolis v. 28.10.
DESTATIS (2013): Zuwanderung nach Deutschland steigt im 1. Halbjahr
2013 um 11 %,
in: Pressemitteilung Statistisches Bundesamt Wiesbaden v. 21.11.
Wie schnell
Bevölkerungsvorausberechnungen veraltet sind, das lässt
sich an der 12. Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2009
demonstrieren, die vor genau 4 Jahren erstellt wurde. Danach
war man von einem permanenten Bevölkerungsrückgang in
Deutschland ausgegangen.
| |
|
Jahr |
Bevölkerungsstand (gemäß Statistischer Jahrbücher) |
Bevölkerungsstand (gemäß Homepage DESTATIS) |
|
2009 |
81
802 |
81
802 |
|
2010 |
81
752 |
81
752 |
|
2011 |
81
844 |
80
328 |
|
2012 |
82
040* |
80
524 |
|
|
*
Fortschreibung ohne Zensuskorrektur (eigene Berechnung) |
Das Statistische Bundesamt
hat auf seine Fehlprognosen schnell reagiert und inzwischen
auf seiner Homepage für die Jahre 2011 und 2012 die
niedrigeren Bevölkerungszahlen, die sich aus dem Zensus 2011
ergeben haben, publiziert. Merkwürdigerweise gilt das für die
Geburtenrate jedoch nicht.
Es ist ersichtlich, dass
die Bevölkerung seit 2010 gewachsen ist (während die Homepage
ein Wachstum erst ab 2011 suggeriert, denn ein Hinweis auf die
Zensus-Korrektur fehlt), also kaum, dass die
Bevölkerungsvorausberechnung publiziert war. Nichtsdestotrotz
werden uns andauernd Vorausberechnungen für die Jahre 2030
oder gar 2060 präsentiert. Was sind solche Berechnungen wert,
außer dass damit politisch Missbrauch getrieben wird?
Zusätzlich zu denken geben
sollte, dass ca. 1,5 Millionen Deutsche weniger per Zensus
2011 die vergangenen Jahre nicht aufgefallen sind.
RÖTZER, Florian (2013): Demografische Spielereien.
In Großbritannien könnte sich
die Bevölkerung in 100 Jahren verdoppeln, in Deutschland ist
entgegen den Vorhersagen die Bevölkerung gewachsen,
in:
Telepolis v. 13.12.
KNÖDLER, Gernot
(2013): Überwiegend Schwund im Norden.
Wandel: In Norddeutschland
werden in Zukunft immer weniger Menschen leben. Vor allem die
Jungen zieht es in die Städte. Das heißt aber nicht, dass
ländliche Gebiete in Zukunft keine Chance mehr hätten,
in:
TAZ Nord v. 14.12.
HASEBORG,
Volker ter/MIKUTEIT, Hanna-Lotte/SCHWENTKER, Björn (2013): Die
Volks(ver)zählung.
Dossier:
Plötzlich gab es 83.000 Hamburger weniger. Ganz offiziell. Denn
so ergab es der Zensus, eine hochgerechnete Stichprobe,
organisiert vom Statistischen Bundesamt. Doch die Zweifel werden
immer größer. Zu viele Fehler, zu viele Widersprüche,
in:
Hamburger
Abendblatt v. 21.12.
Weil der Zensus 2011 für
einzelne Städte und Gemeinde Nachteile bringt, ist der Zensus
umstritten. So muss z.B. die Stadt Hamburg nun 75 Millionen
Euro in den Länderfinanzausgleich nachzahlen, statt wie bisher
sich daraus bedienen zu dürfen. Bei Unterschreitung der 20.000
Einwohnermarke verliert eine Kommune wie Quickborn
Zuständigkeiten in der Verwaltung. Die Autoren schreiben:
"Rund 50 Gesetze und
Verordnungen hängen am Zensus-Ergebnis. Es bestimmt, welches
Bundesland in den Finanzausgleich einzahlt, und welches Land
Geld bekommt. Die Einwohnerzahl entscheidet darüber, wie
viele Flüchtlinge die Bundesländer aufnehmen müssen. Und wie
die Wahlkreise zugeschnitten werden. Sie entscheidet, wie
viel Geld Bürgermeister verdienen und wie viele
Gemeindevertreter in den Kommunalvertretungen sitzen. Auch
in den Beziehungen mit den anderen EU-Ländern wird sich das
Ergebnis im kommenden Jahr auswirken."
Die Frage stellt sich
jedoch, warum gibt es keinen vergleichbaren Widerstand gegen
die amtliche Statistik, wenn NUR Bürger von den Auswirkungen
der fehlerhaften amtlichen Statistik betroffen sind? So wurde
z.B. erst ab 2008 die Kinderlosigkeit in Deutschland durch den
Mikrozensus erfasst (jedoch nur alle 4 Jahre!). Das
Bundesverfassungsgericht verurteilte jedoch Kinderlose auf
Basis falscher Schätzungen bereits 2001 zu einem höheren
Beitragssatz in der Pflegeversicherung. Niemand stört sich
daran, dass die Pflegeversicherung keine Daten dazu liefert,
wie viele Kinderlose von der höheren Beitragszahlung betroffen
sind.
Und wie steht es mit den
Singles? Bis heute werden Paare ohne gemeinsamen Haushalt in
der amtlichen Statistik wie Partnerlose geführt. Selbst
gleichgeschlechtliche Paare werden amtlicherseits geführt.
Haushaltsübergreifende Bindungen werden dagegen negiert,
obgleich diese unsere Städte z.B. in Form von Multilokalität
verändern. Mitte der 1990er Jahre berechnete der
Sozialstrukturforscher Stefan HRADIL auf Basis falscher
Annahmen zur Entwicklung Alleinlebender den Pflegebedarf
aufgrund des steigenden Singleanteils.
Eine
Überprüfung anhand der tatsächlichen Entwicklung des
Pflegebedarfs zeigt, dass der Einfluss der steigenden Zahl von
Alleinlebenden auf den Pflegebedarf wesentlich geringer ist.
Was ist also aus all diesem "Datenmüll" geworden, mit dem man
die Bevölkerung im Zeichen des angeblichen Sachzwangs
"Demografischer Wandel" gefüttert hat? Wer überprüft
eigentlich die Annahmen der Vergangenheit, damit daraus für
die Zukunft gelernt werden kann? Offenbar kein
Datenjournalist!
Wenn also das Gehalt eines
Bürgermeisters negativ von der mangelhaften Erhebung
statistischer Daten betroffen ist (wie viel Bürgermeister
verdienen durch den Zensus eigentlich mehr?), dann kümmern
sich plötzlich Datenjournalisten im Namen der Transparenz um
die Angelegenheit. Wenn dagegen Millionen von Bürgern von
mangelnder Transparenz betroffen sind, dann ist das den
Datenjournalisten völlig egal.
|
|